Hinweis
Erschienen ist dieser Text in:
- Rost, Martin, 1997: Anmerkungen zu einer Soziologie des
Internet; in: Gräf, Lorenz/ Krajewski, Markus (Hrsg.), 1997:
Soziologie des Internet. Handeln im elektronischen Web-Werk,
Frankfurt am Main: Campus, Seite 14-38
- http://www.maroki.de/pub/soziologie/1997_sdi.html
1997.01, Version 1.0
Anmerkungen zu einer Soziologie des Internet
Aus der Sicht der Techniksoziologie gilt es, nicht nur die neuen Formen der Kommunikation und die Folgen für Menschen, Organisationen und für die Gesellschaft insgesamt zu erforschen, sondern Computernetze selbst noch als einen "sozialen Tatbestand" (Durkheim, 1895) auszuweisen. Erste Überlegungen zu einer Soziologie des Internet schließen an den Begriffen der Techniksoziologie sowie an dem Schichtenmodell der Netztechnik an. Im Zentrum der Ausführungen steht der Begriff Protokoll. (Fußnote 1: Bedanken möchte ich mich herzlich zumindest bei denjenigen, die Vorversionen dieses Textes kommentierten: Torsten Böhm, Dipl. Soz. Gerd Breitkreuz, Prof. Lars Clausen, Dr. Ursula Pasero und MA Michael Schack.)
Techniksoziologische Grundbegriffe: Arbeit, Algorithmus, System
Techniksoziologisch nimmt Technik den gleichen Status wie Ökonomie, Politik, Kultur, Religion, Wissenschaft ein (vgl. Hochgerner, 1986). Dem techniksoziologischen Verständnis nach sind technische Funktionen eine Form sozialer Funktionen, eine soziale "Realität sui generis" (Durkheim, 1895) und können somit nicht mehr zu "bloß technische Funktionen" trivialisiert werden.
Der Techniksoziologe Volker von Borries hat in seinem Buch mit dem programmatischen Titel "Technik als Sozialbeziehung" (Borries, 1980) gezeigt, daß ein technischer Gegenstand soziologisch als eine Figuration im Elias'schen Sinne (Elias, 1970) erklärbar ist. Borries weist ein Artefakt als eine in Material gegossene Form der Interaktion, so nennt er es, zwischen dem Kapital-, dem Design-, dem Arbeitsprinzip und dem Anwender aus. Konkret nimmt er
-- Ende S. 14 --dabei Werkzeuge in den Blick. Borries Theorie ist noch klar verankert in der auf Arbeit gründenden dialektisch orientierten Praxisphilosophie (vgl. Kossik, 1967). Thematisch aktueller, aber in der gleichen Theorietradition stehend, weist Bernward Joerges Technik als einen materialen Typ sozialer Normen aus (vgl. Joerges, 1989).
Den Richtungswechsel, den die allgemeine Soziologie seit etwa Ende der 70er Jahre von Dialektik auf Systemtheorie teilweise vollzieht, hat die Techniksoziologie im etwa vergleichbaren Ausmaß mit vollzogen, allerdings ohne sich dabei das Beharren auf die gegenständliche Seite von Gesellschaft respektive von Technik ausreden zu lassen. (Fußnote-2: Die Techniksoziologie kann, um es anders zu formulieren, weder von Marx noch von Luhmann lassen, was zu ihrer anhaltenden Unruhe und den offensichtlichen Inkonsistenzen (siehe die theoretisch stark divergierenden Beiträge in Weingart, 1989) führt.) Alle Techniksoziologen, von Hans Linde (Linde, 1972) bis zu Jost Halfmann (Halfmann/Bechmann/Rammert, 1995) sehen sich genötigt festzustellen: "Das wichtigste (und wohl auch noch nicht abschließend geklärte) Problem der Techniksoziologie ist nach wie vor: ob und in welchem Sinne Technik 'Vollzug' von Gesellschaft ist." (Halfmann, 1995, 10).
Im Zuge dieses Schwenks und als Versuch, der Techniksoziologie zu neuer Konsistenz zu verhelfen, liegt es nahe, auch Technik nicht mehr als eine materiale Form der praktischen Vermittlung von Subjekt, Gesellschaft und Natur, sondern als eine konditioniert-reproduktive Kette kommunikativer Ereignisse im Sinne eines sozialen Systems zu rekonstruieren. Während in der dialektischen Tradition das Bestimmende von der Vermittlung ausgeht (vgl. Israel, 1979), so geht dieses in der Systemtheorie umgekehrt von den Systemen aus, wobei die Systeme die zu Umweltstörungen trivialisierten Vermittlungen gemäß systemeigener Prozesse und Strukturen anschließen (vgl. Luhmann, 1984).
Das Autorenteam um Bamme (Bamme et al., 1983) bereitete diesen paradigmatischen Schwenk der Techniksoziologie dadurch vor, indem es entdeckte, daß das Maschinelle an der Dampfmaschine nicht aus deren materialen Gestalt bestand, sondern aus dem in Stahl gegossenen Algorithmus. Hiernach wäre auch ein Werkzeug ein materialgewordener Algorithmus. Mit Algorithmus stand ein Begriff zur Verfügung, der in sicherem Fahrwasser der in der Soziologie gebräuchlichen Begriffe schwamm, weil er sich als weitgehend deckungsgleich mit Regeln und Normen erwies. Zudem gestattete er dieser Theorietra-
-- Ende S. 15 --dition besonders überzeugend, über das Sohn-Rethel'sche Universalscharnier der Warentausch-Abstraktion (Sohn-Rethel, 1937), Logik und gesellschaftliche Praxis miteinander zu koppeln.
Mit diesem Schwenk wurden die Informations- und Kommunikationstechniken (Pool, 1977; Giesecke, 1990, 1992; Flichy, 1994) und speziell der Computer (bspw. Geser, 1989; Rammert et al., 1989; Esposito, 1993; Heintz 1993) thematisiert. Die Prototechnik der Industriellen Revolution bestand nun nicht mehr nur aus der Dampf- oder der Werkzeugmaschine (oder etwas abseitig: der Zeitmaschine (vgl. Mumford, 1964)), sondern ihr Erscheinen wurde auf den Buchdruck mit beweglichen Lettern vorverlegt (vgl. Eisenstein, 1983) und in eine Tradition der Verschriftlichung von Kommunikationen eingepaßt (vgl. Goody, 1986; Ong, 1987; Haarmann, 1990).
Mitte der 80er Jahre setzte in Deutschland die Technikgeneseforschung (Übersicht: Strangmeier et al., 1992) ein, die sich nicht mehr mit der bloß reaktiven Analyse von Technikfolgen bescheiden wollte (vgl. Dierkes, 1990; Rammert, 1990). In diesen Forschungen wurde die Evolution klar umrissener Artefakte weitgehend an die Rolle individueller Akteure (Erfinder, Konstrukteure, Promotoren) gebunden. Diese primär am einzelnen Akteur ansetzende Argumentationsfigur war nicht länger durchzuhalten, als dann großtechnische Systeme wie Elektrizitätsnetze (Hughes, 1983), Ver- und Entsorgungssysteme (Braun, 1994) sowie Verkehrs- (Salsbury, 1988) und Kommunikationssysteme (Geistbeck, 1895; Eveland/Bikson, 1987; Holling/Kempin, 1989; Schneider, 1989; Thomas, 1995) in den Forschungsblick gerieten. Renate Mayntz (Mayntz, 1993) schlug vor, großtechnische Systeme in den Rang eines gesellschaftlichen Teilsystems zu erheben und ihnen eine den politischen und ökonomischen Teilsystemen analoge Bedeutung zuzugestehen. (Fußnote-3: Im Urteil von Bernward Joerges (Joerges, 1994, 28-29) steht die genaue Bestimmung jedoch aus, ob wirklich den technischen Systemen oder den sie umschmiegenden Großorganisationen diese gesellschaftstheoretische Aufwertung zugute kommen müsse.)
Damit wurde erneut ein Leitbegriff der Techniksoziologie ausgetauscht. Es formierte nicht mehr der Begriff des Algorithmus die techniksoziologische Theoriebauphantasie, sondern der des (großtechnischen) Systems. Und genau wie der Algorithmusbegriff umstandslos an traditionelle soziologische Begriffe ankoppelbar war, so scheint gleiches mit dem Systembegriff der Fall zu sein. Zumindest auf der vordergründig syntaktischen Ebene ist es denkbar geworden, "sowohl den Hardware-Systembegriff der Ingenieure, der physische
-- Ende S. 16 --Artefakte umfaßt, als auch den Sinn-Systembegriff der Soziologie, der Kommunikationen umfaßt", zusammenzuführen (vgl. Grundmann, 1994, 502).
So weit in aller Kürze der Stand der Diskussion auf der techniksoziologischen Seite. Nun gilt es, ein Modell von Computernetzen soziologisch anschlußfähig aufzurauhen.
Zur Bestimmung von Computernetzen
Der Begriff Computernetz bezeichnet "mehrere miteinander verbundene, unabhängige Computer" (Tanenbaum, 1990, 2). Die Funktion von Computernetzen besteht darin, als Medium zum Transport von Computerdaten beliebigen Inhalts zu operieren.
Computernetze werden traditionell gemäß ihrer Ausdehnung als LAN (Local-Area-Network), MAN (Metropolitan Area Network) sowie WAN (Wide-Area-Network) bezeichnet (vgl. Tanenbaum, 1990). Etwa Mitte der 90er setzte sich daneben die Unterscheidung von Internet und Intranet durch. Mit Internet wird in der Regel ein weltumspannendes, universal nutzbares Computernetz (daher macht die Datenautobahn-Metapher einen gewissen Sinn, vgl. Canzler, 1995) bezeichnet, mit Intranet demgegenüber ein organisationsintern betriebenes Computernetz. (Fußnote-4: Der Begriff Intranet wurde in diesem Sinne bereits 1980 im RFC753 (Request For Comment) verwendet. RFCs sind Veröffentlichungen mit praktisch erprobten Empfehlungen für Netztechnik und -organisation des Internet (siehe RFC, o.J.).)
Anhand der einfach anmutenden Frage, wer in Deutschland computervernetzt kommunizieren kann, läßt sich zeigen, daß die Bestimmung eines Computernetzes allein in technischer Hinsicht schon ziemlich verwickelt ist (siehe Abbildung 1, rechte Säule):
- Die erste Schicht ist die der Hardware. Damit sind
die Computer und die gegenständliche Seite der
Übertragungstechnik (sprich: Kupferkabel, Glasfasern oder
Funkstrecken etc.) gemeint. Diese Schicht greift auf ein Medium zu,
welches die Eigenschaft aufweist, perfekt stetig und kontinuierlich zu
sein und beliebige Unterschiede mit fast freibestimmbarer Körnung
-- Ende S. 17 --
ausformen zu können. Diese Eigenschaften weisen derzeit am besten Strom und Licht auf.
- Die darauf aufsetzende Schicht ist die des Netzprotokolls, die als eine Art Betriebssystem eines Netzes fungiert, und die beim Internet als TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) bezeichnet wird.
- Auf die Protokollschicht setzt die Schicht mit den Netzdiensten auf, also z.B. E-Mails, Newsgroups, Datenbankabfragen per Telnet, FTP- und WWW-Server mit den entsprechenden Adressierungsregeln und Befehlsets auf der Anwendungsseite (vgl. zur Anwendung von Netzen: Rost/Schack 1995).
Je nachdem, welche der drei Schichten man nun zugrundelegt, sind unterschiedliche Grade der technischen Vernetzung zu bestimmen. Betrachtet man die Kabelstrangebene, konkret etwa in Form des Telefonnetzes, so ist nahezu perfekt jeder deutsche Haushalt (35,7 Millionen Haushalte (1992), 37 Millionen Telefonanschlüsse (1993) - Statistisches Bundesamt 1994) vernetzt. Betrachtet man die Protokollebene, so waren in Deutschland 1,3 Millionen Personen per TCP/IP vernetzt (Stand: Mai 1996, vgl. Borchers, 1996). Und interessiert man sich für die Vernetzung auf Anwendungsschicht und beispielsweise für die Frage, wer in Deutschland E-Mail empfangen und verschicken kann, so kommt man auf etwa 1,7 Millionen Personen.
Zugeschnitten auf das Internet als Netze vernetzendes Computernetz, wird die Anzahl der zum Internet zusammengebundenen Rechner, in einer bedächtigen Untersuchung (vgl. Lottor, 1996), auf 12,8 Millionen bei etwa jährlicher Verdopplung geschätzt (Stand: Juli 1996). Und in einer problembewußten Anwender-Studie (MIDS, 1996) ist von weltweit 26,4 Millionen Anwendern die Rede (Stand: Februar 1996).
Diese Einteilung in drei Schichten zur Bestimmung eines Netzes stellt eine vergröberte Variante des ISO-7-Schicht-OSI-Modells (vgl. Tanenbaum, 1990; siehe Abbildung 1, linke Säule. Zu den "Prinzipien der Siebenschichtigkeit": Tanenbaum, 1990, 17) dar, mit dem die Netzwerktechniker operieren. Das hier vorgestellte Dreischicht-Computernetz-Modell ist für soziologische Belange zunächst hinreichend genug differenziert, weil es primär darum geht, den Begriff Protokoll herauszuarbeiten.
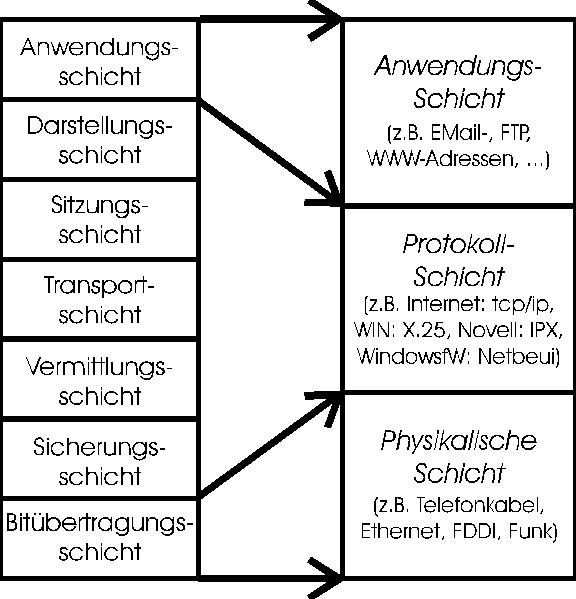
Um Computernetze (wie z.B. das WiN-genannte deutsche Wissenschaftsnetz, das uucp-Netz, das FidoNet, CompuServe, AOL, T-Online usw.) voneinander zu unterscheiden, reichen diese drei technischen Kriterien nicht aus.
-- Ende S. 18 --Viele Netze basieren auf exakt der gleichen Technik, sind aber trotzdem unterscheidbar (eben: WiN, AOL, FidoNet, ..., Internet). Es müssen deshalb zu den drei technischen noch mindestens drei soziale Kriterien hinzugenommen werden: nämlich die Programmatik einer Organisation, die einen Zugang zum Netz unterhält (ökonomische-, wissenschaftliche- und politische Programmatik), die Verwaltung eines Netzes (zentralistisch oder dezentral-selbstorganisiert) sowie die Zugänge zum Netz (öffentlich/nicht-öffentlich) (siehe Abbildung 2). (Fußnote-5: Wir haben das für verschiedene Netze durchdekliniert in: Rost/Schack 1995: 45ff.)
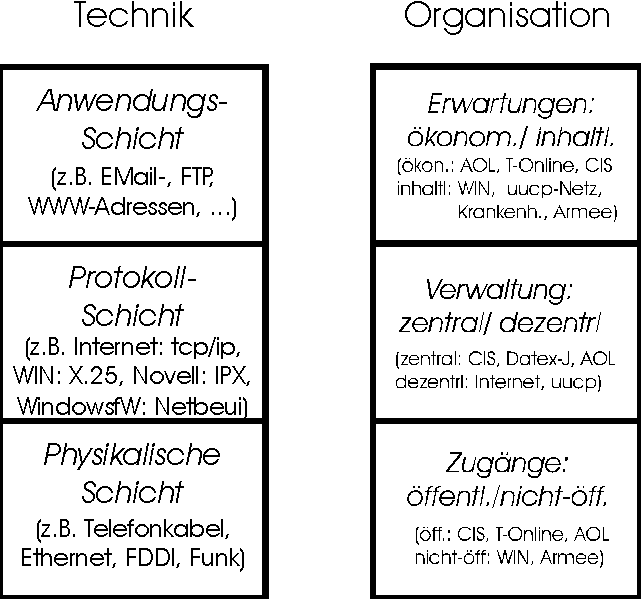
Das besondere am Internet als Computernetz besteht darin, daß es als ein "Netzevernetzungsnetz", wie es der Name bereits andeutet, fungiert. Das Internet wird auf Basis der gesamten Palette an Hardware und Programmen, mit allen nur erdenklichen Motiven und von offen zugänglichen oder geschlossen operierenden Benutzergruppen genutzt. Charakteristisch für das Internet ist, daß das Internet-Protocol (IP gemäß RFC791) eingesetzt wird, die Rechner untereinander jederzeit kontakten können und der Netzbetrieb über verteilte Network-Informations-Center (NIC, die Adresse des globalen InterNIC-
-- Ende S. 19 --Nameservers lautet: ns.internic.net) koordiniert wird (vgl. Köhntopp, 1996). Da in Computernetzen auch andere Protokolle als IP benutzt werden und Rechner einander zwar nicht jederzeit kontakten (weil sie z.B. Daten mit den Protokollen uucp oder zmodem tauschen) aber trotzdem E-Mails zustellen können, so macht es Sinn, noch das Internet und die weltweite Gesamtnetzinfrastruktur, die von Quatermann als Matrix bezeichnet wird (vgl. Quarterman, 1990), zu unterscheiden, soweit diese einen Zusammenhang bildet (etwa dadurch, daß E-Mails über Netzgrenzen zugestellt werden können). Das Internet ist dabei als Referenz für die Analyse von Computernetzen besonders geeignet, weil es in Kontakt mit sämtlichen Realisationen von Computernetzen steht und in der Funktion als Netzevernetzungsnetz bereits eine eigendynamische Entwicklungstypik ausgebildet hat.
Das Internet setzt auf anderen Netzen auf. Zu diesen anderen Netzen zählen betriebseigene Computernetze ebenso wie Kommunikationsnetze (Telefonnetz, ISDN-Netz, Datex-P-Netz, Funkstrecken usw.) oder Elektrizitätsnetze. Ingo Braun hat für großtechnische Systeme, die ihrerseits auf großtechnischen Systemen basieren, den Begriff des "Großtechnischen Systems 2. Ordnung" (Braun, 1994, 483ff) vorgeschlagen. Die Richtung dieses Vorschlags, nämlich eine weitere Dimension für aggregierte Formen von Repräsentationen großtechnischer Systeme in großtechnischen Systemen zu öffnen, finde ich angemessen. Ich möchte Brauns Vorschlag jedoch aus zwei Gründen nicht übernehmen:
-- Ende S. 20 --- Die Abhängigkeit der verschiedenen Formen von Netzen voneinander ist vergleichbar groß. Auch ein Energienetz wie ein Stromnetz ist auf ein funktionierendes Informationsnetz, und seien es zunächst berittene Boten auf Trampelpfaden oder seien es Morseapparate, angewiesen, um überhaupt erst einmal einen verläßlichen Zustand herzustellen. Die verschiedenen großtechnischen Systeme setzen sich für ihr Funktionieren gegenseitig voraus, weshalb eine hierarchische Anordnung gemäß 1. und 2. Ordnung eine falsche Vorstellung der gegenseitigen Abhängigkeit erzeugt. Es gilt vielmehr, sich auf ein gegenseitiges Steigerungsverhältnis von großtechnischen Systemen gefaßt zu machen, die sich zu einem gesamtgesellschaftlichen Technikteilsystem funktional ausdifferenziert haben. Ich möchte die These wagen: Ohne großtechnische Kommunikationssysteme entstehen keine großtechnischen Energiesysteme und umgekehrt.
- Auf Basis des Internet setzen weitere Formen von Vernetzungen
ein. So bildet das WWW über das Vernetzungsprotokoll http
(Hypertext-Transfer-Protocol) ein
solches Netz, das wiederum das Medium für per html
(Hypertext-Markup-Language) vernetzte
Texte bildet. Man spricht in anderen Zusammenhängen von einem
Overlay-Netz (etwa: das Usenet), das auf der technischen
Infrastruktur bestehender Netzwerke aufsetzt. Groupware,
Shared-Editing, Workflow usw., alle Arten von CSCW (Computer
Supported Cooperative Working, vgl. Malm,
1994; Stodolsky, 1994; siehe Abbildung 4) oder EDI (Electronic
Data Interchange, vgl. Deutsch, 1995) basieren auf
solchen Kommunikationsprotokollen. Es lassen sich insofern viele
weitere Ebenen mit Protokollen und Repräsentationsformen
für Mitteilungseinheiten in dem Universal-Kommunikationsmedium
Internet einziehen. Wenn beispielsweise Firmen über das Internet
kommunizieren und diese ihre Daten im SGML-Format (Standard
General Markup Language, vgl. Rieger, 1995)
strukturiert austauschen, so wäre auch dies eine Vernetzung, die
auf dem Kommunikationsnetz aufsetzte und über ein eigenes
Protokoll verfügte. Folgte man dem Braunschen Vorschlag, so
läge es nahe, hier von Systemen 3., 4., 5., ... Ordnung zu
sprechen. Das wäre konzeptionell wenig befriedigend, weil
beliebig. Stattdessen scheint es mir konsistenter, im
großzügigen Anschluß an den Vorschlag von Mayntz, ein
großtechnisches System wie das Internet als einen Teil des
gesellschaftlichen Techniksystems zu begreifen und für jedes
Technikteilsystem verschiedene Protokollschichten zu unterscheiden.
-- Ende S. 21 --
Protokolle
Der Netzwerker Marshall T. Rose definiert ein Protokoll wie folgt:
"Physically connecting computers isn't enough to achieve mobility of information. The computers must adhere to a common set of rules for defining their interactions, i.e., how they talk to one another. How computers talk to one another is termed a protocol. Protocols defined in terms of a common framework and administrated by a common body form a protocol suite." (Rose, 1991, 4)
Protokolle in Computernetzen haben sicherzustellen, daß die Datenpäckchen rechtzeitig eintreffen und wieder in der Reihenfolge zusammengesetzt werden, in der sie abgeschickt wurden. Protokolle regeln, wann ein Transport als abgeschlossen zu gelten hat, wiederholt werden muß oder zu unterbrechen ist (zur Komplexität moderner Netzprotokolle: Hosenfeld, 1996; Jaeger, 1996). Protokolle spielen in den jeweiligen Formen einer Schicht eine Rolle: sei dies als RTS/CTS (Ready-To-Send/Clear-To-Send bei einer Modemverbindung) auf der Datenleitung, als Transport-, Fehler-, Kooperations- (Groupware) oder Verschlüsselungsprotokoll der Datenpäckchen oder in der "weichen" Form der Empfangsbestätigung des Empfängers an den Sender.
Protokolle regeln den Anschluß von Einheiten horizontal innerhalb einer Schicht sowie die Abbildung der einen Schicht in der benachbarten: Kabel schließt an Kabel an, Strom an Strom, Bitstream an Bitstream, Datenpäckchen an Datenpäckchen, E-Mail an E-Mail, Zeichen an Zeichen, (dann weiter: Argument an Argument, Zahlung an Zahlung, Bild an Bild, ...), jeweils im Hinblick auf den Erhalt von Informationen auch in der vertikalen Dimension (dazu: Winograd/Flores, 1986, 141ff). Solange diese Adäquanz der Repräsentationen erhalten bleibt, handelt es sich in horizontaler und vertikaler Dimension um ein geschlossenes technisches System.
Insofern ist der Begriff des Protokolls innerhalb einer Schicht spezifizierbar analog zu einem Algorithmus ("endlicher Automat", vgl. Tanenbaum, 1990). Auf die Anwendungsschicht eines Netzes wirkt sich das Netzprotokoll als Regeln der Formulierung von Adressen aus (Telefonnummer einer Mailbox, E-Mail-Adresse des Empfängers, Adresse eines WWW-Servers oder FTP-Servers, einer per-Telnet-erreichbaren-Datenbank usw.). Diese Angabe von Adressen veranlaßt Computer zu Interaktionen mit anderen Computern, weshalb man auch auf dieser Schicht netzwerktechnisch von einem Protokoll sprechen muß. Die Anwendungsschicht bildet aber auch die Schnittstelle des technischen Systems Computernetz als Medium für Sozialsysteme und Be-
-- Ende S. 22 --wußtseinssysteme. Auf dieser Schicht wirken sich für Anwender erkennbar Organisationsregeln oder juristische Bestimmungen dadurch aus, indem zum Beispiel von betrieblichen Rechenzentren nur bestimmte Dienste zugelassen sind, der Datentransfer gesondert gegen Spionage gesichert ist oder eine unkomfortable, weil billige Netz-Software eingesetzt wird und dergleichen mehr. Realisiert werden diese Regeln in dieser Schicht aber spezifisch technisch als Protokoll.
Die Protokollschicht entspricht dem allgemein-abstrakten Modell eines Computernetzes. Eine techniksoziologische Aufbereitung von Computernetzen sollte deshalb an der Protokollschicht ansetzen. Zum einen wird die netzeigene Dynamik und Problemtypik auf der Protokollebene besonders deutlich. Zum anderen eignet sich der Protokollbegriff, um die Schnittstelle zwischen Computernetzen, Sozialsystemen und Bewußtseinssystemen zu spezifizieren.
Ist vom Protokoll ohne eine bestimmte Schicht zu spezifizieren vertikal über sämtliche Schichten hinweg die Rede, so soll dies einem systemtheoretischen Begriff von Protokoll schlechthin entsprechen. In diesem Sinne lassen sich großtechnische Systeme und sämtliche Klassen an Artefakten (also auch Werkzeuge und Maschinen) anhand unterschiedlicher protocol suites unterscheiden. (Fußnote-6: Womöglich ist es aussichtsreich, den an Computernetzen geschärften Begriff des Protokolls in die soziologische Systemtheorie zu importieren, ihn zu verallgemeinern und den an Algorithmus erinnernden Begriff des Programms dadurch zu ersetzen. Für Protokolle gilt alles, was auch für Programme gilt (Luhmann, 1986; Luhmann, 1990), nur ermöglicht der Begriff des Protokolls, die Regeln des Aufbaus/Abbaus von Kommunikationen anhand von vorausgehenden Kommunikationen detailierter zu beobachten.)
Technik als Sozialsystem
Ein Computernetz wie das Internet zählt zu den großtechnischen Systemen. Groß bezieht sich darauf, daß es seinerseits auf Maschinen, Computern und Computernetzen basiert und weltweit als Universalmedium für Kommunikationen dient. Es ist technisch, weil es eine materiale Seite hat und eine ganze Anzahl an Regeln, Algorithmen und Protokollen beinhaltet. Und es ist ein System, weil sich die Kommunikationen in Form von Artefaktanschlüssen von
-- Ende S. 23 --ihrer Umwelt klar unterscheiden lassen und diese einer primär technisch orientierten Eigendynamik der Entwicklung unterliegen.
Das Internet ist damit jedoch noch kein Sozialsystem im Luhmannschen Sinne autopoietisch operierender Systeme. Ein Computernetz läßt sich jedoch als ein Teil des gesellschaftlichen Techniksystems begreifen, welches womöglich insgesamt als ein autopoietisches Sozialsystem operiert, wenn dem Grundgedanken zugestimmt werden kann, daß Technik selbst noch als eine bestimmte Form von Kommunikation operiert, die eigendynamisch auf eine unwiderstehliche Weise, nämlich kontingent-produktiv, dynamisch stabil und ihre Umwelt als Störungen selektiv wahrnehmend, nur an sich selbst bestimmt sinnhaft anschließt. Die Anschlüsse von Artefakten an Artefakten oder von Datenpäckchen an Datenpäckchen durch Protokolle wären dann technischer "Vollzug von Gesellschaft" (Jost Halfmann). Auch das einzelne Artefakt als soziales Ereignis wäre bei genügend feiner Auflösung als Anschluß sozialer Ereignisse zu verstehen. Eine derart systemtheoretisch orientierte Techniksoziologie folgte insofern nicht der Perspektive der "Materialität der Kommunikation" (Gumbrecht/ Pfeiffer, 1988), sondern umgekehrt der der Kommunikation des Materialen.
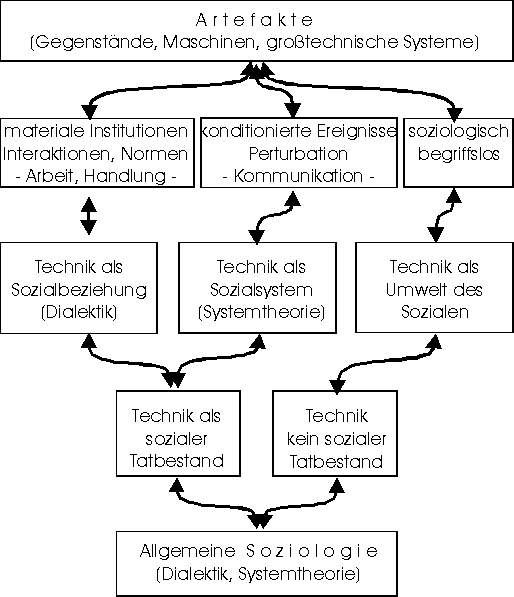
Es ist an dieser Stelle nicht möglich, sämtliche Begriffe einer Soziologie des Internet als Teilsoziologie der Techniksoziologie zu er- und bearbeiten, um die Frage zu beantworten, inwieweit das Internet als Teil eines symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums Technik (vgl. Luhmann, 1990) oder (konzeptuell: nur) als eine massenmediale "Verbreitungstechnologie" (vgl. Luhmann, 1996) aufzufassen wäre. Ich möchte mich deshalb kurz auf die systemeigenen Anschlüsse der Technik und auf die Perturbationen seitens der Umwelt konzentrieren, die speziell beim Internet eine Rolle spielen und in denen den Protokollen eine entscheidende Bedeutung zukommt.
Geld/Haben, Macht/Entscheiden und Wahrheit/Wissen sind bekanntlich die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien, die über Preise, Gesetze und Methoden als Programme die Paradoxien (insbesondere beim Wiedereintritt der Form in die Form) zwar nicht (auf)lösen, aber den Seitenwechsel praktisch (Fußnote-7: Dies ist eine breite Kontaktstelle zwischen Hegel/Marx und Spencer Brown/Luhmann.) handhabbar konditionieren. Hiernach provoziert die unhintergehbare Latenz der Paradoxien ihre eigene Bändigungspraxis. Das gleiche gilt nun für Technik/Probleme, deren Paradoxien, beim "Worst-Case" des Wiedereintritts der Form in die Form, spezifisch technisch konditioniert werden. Proble-
-- Ende S. 24 --me sind das Programm des Techniksystems. Sie werden spezifiziert als Regeln (Werkzeuge), Algorithmen (Maschinen) und Protokolle (großtechnische Systeme). So in Form des Weitermachens oder Stoppens des Handwerkers beim Herstellen eines Werkzeugs mittels Werkzeugs, des rechtzeitigen Öffnens oder Schließens von Reglern bei Maschinen oder des Aufbaus/Abbaus von Verbindungen (etwa als Straßenbau, Kanalbau, Kabelverlegen oder Protokollkontakt zwischen Netzservern) in großtechnischen Systemen.
Werkzeug, Maschine und großtechnisches System sind bezogen
auf das Sozialsystem oder das Bewußtseinssystem als solche
bestimmbar. Für ein Bewußtseinssystem sind E-Mail und
Computer Werkzeuge, die regelhaft anzuwenden sind. Beobachtet eine
Organisation E-Mail und Computer, so sind es diese Maschinen, die
funktional ineinander verschränkt eine "Maschinerie" (Marx, 1867)
ausbilden. Bezogen auf Gesellschaft sind E-Mail und Computer
Bestandteile eines großtechnischen Systems. Diese zuletzt
aufgeführte Perspektive versucht dieser Text einzunehmen.
-- Ende S. 25 --
Die Verselbständigung des Technischen zu einem eigenständigen Sinnsystem zeigt sich bereits bei einem Universal-Werkzeug wie dem Steinwerkzeug (Pebbletool). Ein Pebbletool ist Werkzeug und Gegenstand, Form und Medium, das als Werkzeug hart und als Gegenstand weich, eng und lose gekoppelt zugleich sein muß. Dadurch daß es hier zur Ausbildung einer Form kommt, und dabei eine Seite festgehalten und die andere variiert wird, handelt es sich um eine Form gesellschaftlicher Kommunikation. Beim Wiedereintritt der Form in die Form wird die Form zum Medium (vgl. Spencer Brown, 1969). Auch die Ausbildung der Universal-Maschine Dampfmaschine/Werkzeugmaschine (später dann ist diese Universalmaschine, auf Basis eines stabilen großtechnischen Systems, der Stromgenerator vereint mit dem Elektromotor) unterliegt einer Konditionierung einer Paradoxie. Hier gelingt es, ein gegenseitiges negentropisches Steigerungsverhältnis herzustellen, indem zwei Formen im gleichen Medium ausgebildet werden. (Fußnote-8: Dies könnte ein Grund sein dafür, daß Marx sich nicht für eine der beiden Maschinengattungen, Werkzeugmaschine oder Dampfmaschine, als zentral stehendem Industrialisierungsagenten entscheiden mochte: Die Werkzeugmaschine paßt zu gut in die praxisphilosophische Tradition hinein, und die Dampfmaschine begründet die Verselbständigung der Formbildung der Maschinerie.) Konkret formuliert: Eine schwächere/gröbere Maschine gestattet die Herstellung einer stärkeren/präziseren Maschine, indem eine Dampfmaschine zunächst für die Herstellung einer besonders präzise operierenden Werkzeugmaschine verwendet wird, als Voraussetzung für die Bearbeitbarkeit neuer Materialien, als Voraussetzung für die Herstellung einer leistungsstärkeren Dampfmaschine (erkennbar ist dies am Umstieg von Holzkonstruktionen über Holz-Metall- zu reinen Metallkonstruktionen).
Auch in der Netztechnik zeigt sich, daß das Medium durch die Form zum Medium der Form wird (vgl. Luhmann, 1990, 181ff). Der Kabelstrang, selbst schon eine Form im Medium Kupfer, Glasfaser, Kunststoff ..., dient als Medium für die Form Protokoll, das wiederum das Medium für die Form E-Mail darstellt, das als Medium für die Form Briefkommunikation (mit ihrem weichen Protokoll der Anrede, des Dankes, des Grüßens, ...) genutzt wird. Der technisch-funktionale Eigensinn eines großtechnischen Systems wie dem Internet besteht dabei, um es zunächst knapp auszudrücken, in der Konditionierung der Paradoxie der gleichzeitig stattfindenden Universalisierung und Spezifikation von Protokollen: Die Bildung von Schichten (siehe erneut Abbildung 1) führt einerseits zur fortgesetzten Verbesserung der Ergonomie auf der Anwenderschicht (mit dem WWW als aktuellem Höhepunkt leichter Nutzbarkeit
-- Ende S. 26 --von Computernetzen) und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit auf der Hardware-Seite.
Durch die Industrialisierung des Transmissionsriemens, die zunächst in Form von Gestängen, Zahnrädern und Kupplungen in den Fabriken einsetzte und dann gesellschaftsweit durch die Strom- und nun durch die Computernetze realisiert wird, wird die Verbindung von Produktionsmaschine und Konsumtionsmaschine ein weiteres Mal aufgetrennt und auf industrialisiertem, d.h. technisch und organisatorisch differenziertem Niveau, neu zusammengesetzt. Verbesserte Technik (verbessert im Sinne der gesteigerten Trennschärfe bei der Beobachtung von Wirkung/Nichtwirkung und Nebenwirkung bzw. der Zuspitzung, welches Problem als gelöst gelten darf und welches nicht) im Energiebereich schlägt nicht direkt auf die Technik im Verarbeitungsbereich und umgekehrt durch, sondern verändert zunächst (auch) die Kommunikationstechniken in Richtung auf größere Bandbreiten und leistungsfähigere Selbststeuerung durch Respezifizierung von Protokollen. Kommunikationstechniken wirken zurück auf die Entwicklungen der Energietechnik (z.B. im Bereich der Steuerung von Kraftwerken) und Verarbeitungstechnik (z.B. CAD/CAM-Maschinen), und "vermitteln" so auch wieder zurück auf sich selbst. Diese ziehen die Entwicklung größerer Bandbreiten und geringerer Bauteiltoleranzen nach sich, die wiederum zu leistungsfähigeren Netztechniken (z.B. FDDI (Fiber Distributed Data Interface) oder ATM ( Asynchronous Transfer Modus)) führen. Dadurch verändern sich auch Maschinen und Werkzeuge.
Das Techniksystem schließt Umweltstörungen, insbesondere durch andere Sozialsysteme, gemäß der jeweils systemeigenen Form als Regel, Algorithmus oder Protokoll an. Die technische Seite von Geld enthält z.B. eine "eingebaute" Mitteilung, wie es zu handhaben ist. Die Steuerung der Handhabung als Geld (nicht als Schraubenzieher-Ersatz) obliegt nicht der einzelnen Person oder der ökonomischen Seite des Geldes, sondern dem selegierend-disziplinierenden Design. Liegt Geld beispielsweise in segmentären Gemeinschaften in der Form Muschel oder als Goldstück vor, ist es auch körperlich zu behandeln. Liegt es in funktional-differenzierten Gesellschaften dagegen zusätzlich als E-Cash in einem Chip oder auf einer Festplatte gespeichert vor, ist es automatisiert verrechenbar. In beiden Fällen funktioniert der Verwaltungsoverhead des Protokolls, also die Mitteilung über die Mitteilung als Anweisung, welche Regeln im Umgang mit Geld zu beachten sind. Technisch beobachtet sind diese Seiten eines ökonomischen Systems, das selbst für die material-technische Seite blind ist, nicht vernachlässigbar. Kommunikative Ereignisse beinhalten in diesem
-- Ende S. 27 --Sinne vermutlich immer auch einen technisch bestimmten Verwaltungsoverhead, der die Bandbreite der Möglichkeiten eines Anschlusses beschränkt. Bezogen auf Computernetze bedeutet dies, daß Umweltstörungen als Protokolle beobachtet werden.
Insofern: Über die Protokolle sind großtechnische Systeme wie das Internet an ihre Umwelten gekoppelt: sei dies auf der Anwendungsschicht durch Regeln bei der Adressierung, sei dies als ein Set erwartbarer Funktionen für Organisationen oder sei dies auf der Kabelschicht als eine technische Form gesellschaftlicher Kommunikation überhaupt. So werden denn auch die aktuellen Versuche zur rechtlich angemessenen Einbindung und Ökonomisierung des Internet technisch allesamt als Protokollprobleme formuliert, etwa wenn das Problem bewegt wird, auf welcher Protokollschicht die Authentifizierung des Absenders oder die Verschlüsselung von finanziellen Transaktionen am besten realisiert werden solle (vgl. zur Protokollpolitik: Schmidt/Werle, 1994; Hofmann, 1996; Helmers/Hoffmann/Hofmann, 1996). Als weiches Protokoll ist die Netiquette zu begreifen, ein Text mit Kommunikationsregeln unter den besonderen Bedingungen der Netzkommunikation (vgl. Donnerhacke, 1996).
Die Kommunikationen anderer Sozialsysteme mittels Computernetzen müssen aus technischer Sicht in Protokolleinheiten rekonstruiert werden. Dies hat zur Folge, daß Texte in einem Digitalmedium auf eine spezifisch neue Weise organisiert werden. Das Neue besteht weniger in der Öffnung der Schrift hin zu Multimedia, die durch die Nutzung von Computernetzen stattfindet und die kulturpessimistisch als Renaissance des Ikonenhaften beargwöhnt wird. Und es besteht auch nicht so sehr darin, daß nun jeder Netzteilnehmer als Autor eine weltweite Öffentlichkeit penetrieren kann. Schon das Buch erzielte emergente, nicht-intendierte Wirkungen dadurch, daß der Kontext durch ein anonymes Lesepublikum wechselte. Beim Netz als Kommunikationsmedium entstehen gegenüber dem Papier nicht-intendierte emergente Wirkungen dadurch, daß Mitteilungen selber noch technisch prozessiert werden. Mit Papier als gesellschaftlich etabliertem, technischem Kommunikationsmedium funktionieren Computer lediglich als "komfortable Schreibmaschinen" (Randow, 1996). Werden Computer zu einem großtechnischen System wie dem Internet zusammengebunden und steht ein digitales Kommunikationsmedium durchgängig zur Verfügung, öffnet sich zusätzlich zu den zwei Dimensionen der Materialisierung von Papiertexten eine dritte Dimension. In der durch die Digitalisierung des Kommunikationsmediums eröffneten dritten Dimension lassen sich Texte mit Steueranweisungen zu Texten unterbringen.
-- Ende S. 28 --Für den Wissenschaftsbereich heißt das konkret, daß dort die Kommentare der Autoren und deren Kritiker, die Layoutanweisungen der Textverarbeitungen oder die Steueranweisungen für Suchmaschinen im Internet lokalisiert sind. Die Vorteile einer "Diskurs-Markup-Language", die in dieser dritten Dimension die Arten der Anschlüsse wissenschaftlicher Publikationen an Publikationen kennzeichnen würde, liegen dann auf der Hand (vgl. Rost, 1996c). Im WWW werden automatisch Texte einzelner Autoren zu einem Kollektivtext zusammengebunden. Die in dieser Form von Autoren nicht mehr konzipierbaren Gesamttexte erzeugen bei Lesern Assoziationen, die als ganze prinzipiell nicht mehr in Deckung mit Intentionen einzelner Autoren gebracht werden können (vgl. Groys, 1996; Nickl, 1996). Technisch auf die Spitze getrieben führt die Nutzung der dritten Dimension zu Personal Agents, (Fußnote-9: Ein Personal Agent (auch Roboter, Bot oder Spider genannt) ist ein Programm, das als Netzrepräsentation eines Netznutzers mit einer gewissen Autonomie ausgestattet ist, um als Sekretär im Netz beispielsweise mit einem anderen Personal Agent Termine abzuklären oder innerhalb eines Budgets weltweit günstigst einzukaufen, um nur zwei vergleichsweise unspektakuläre Beispiele zu nennen (vgl. Helmers/Hoffmann 1996; Römer et al., 1996).) die wiederum als Automaten Steueranweisungen auswerten und selbst Steueranweisungen erzeugen.
Mit der Herausbildung großtechnischer Systeme setzt sich die funktionale Differenzierung von Gesellschaft fort. Die Sozialsysteme greifen auf die vorselegierte Komplexitätsreduktion des Techniksystems zu, ohne dadurch die spezifischen Anschlüsse von Technik in ihren Bereich importieren zu müssen. Zahlungen schließen weiterhin nur an Zahlungen spezifisch an, Entscheidungen an Entscheidungen, Publikationen an Publikationen, wenn auch durch den Einsatz moderner Technik in Form von elektronischem Geld (vgl. zur Internet-Ökonomie: MacKie-Mason/Varian, 1995), computernetzgestützten Verwaltungs- und Abstimmungsverfahren oder weltweit operierenden wissenschaftlichen Diskursen in Mailinglists (vgl. Fröhlich, 1993; Rost, 1996a) allerdings ungleich schneller. Das in Anspruch genommene Techniksystem verändert nicht den spezifischen Sinn dieser Anschlüsse, wohl aber die Organisationen, die sich um bestimmte Sets von Kommunikationen gebildet haben. Auf diesen Aspekt der gesellschaftlichen Folgen der Computernetze möchte ich zum Schluß noch kurz eingehen.
-- Ende S. 29 --Computernetze und ihre gesellschaftlichen Folgen
Computernetze werden mit der Öffnung des WWW 1993 im aufgeregten Ton thematisiert. Die Autoren sind sich einig, daß Computernetze enorme soziale Änderungen nach sich ziehen werden. Einige von ihnen loten die Tragweite der Entwicklungen aus (vgl. Rheingold, 1994; Bolhuis/Colom, 1995; Heibach/Bollmann, 1996; Rost, 1996), andere bemühen sich frühzeitig um kritische Einschätzungen (vgl. Goodman, 1995; Stoll, 1995; einige Beiträge in Kuehnheim/Sommer, 1996; Stegbauer, 1996).
Steinmüller konzentriert seine Beobachtungen des sich abzeichnenden krassen sozialen Wandels (vgl. Clausen, 1994) in der These von der Fortsetzung der Industrialisierung (vgl. Steinmüller, 1993). Lutz spricht frühzeitig von einer "Hyperindustrialisierung" (Lutz, 1990, 41ff) durch die neuen Informationstechniken. Mit Blick auf das Wissenschaftssystem, in dem bislang akademische Meister in Wissenschaftszünften zusammengeschlossen handwerkern, neige ich dazu, von einer Fortsetzung und Vollendung des Projekts der Industrialisierung zu sprechen (vgl. Rost, 1996a). Verallgemeinert ließe sich von einer Industrialisierung des gesamten Bereichs der anspruchsvollen Mitteilungsverarbeitung und Mustererkennung (sprich: des Dienstleistungssektors) sprechen. Diese Technisierung schlägt dabei ökonomisch und politisch direkt auf das Urheberrecht durch, weil in einer Informationsgesellschaft zwar jeder Informationsarbeiter professionell kreativ sein muß, aber zugleich der Anspruch des Einzelnen auf geistiges Eigentum obsolet wird (vgl. Barlow, 1995). Die Verwertungsgesellschaften GEMA und Wort sind erste Versuche, dem technisch einfachen und billigen Kopieren mit den dadurch entstehenden katastrophalen Auswirkungen für den einzelnen Produzenten beizukommen. In einer Informationsgesellschaft müssen Probleme dieser Art vermutlich überzeugender gelöst werden. Sozialpolitische Modelle, die die Entkopplung von Arbeit und Einkommen vorsehen (vgl. Vobruba, 1990) und die unter den Begriffen der "allgemeinen Grundsicherung" (vgl. Gorz, 1983; 1989) oder des "Bürgergelds" gefaßt werden, könnten wieder zu ganz neuer Plausiblität gelangen.
Der aufgeregte Ton rührt daher, daß die Computernetze die althergebrachten Kopplungen von Raum, Zeit und Funktionen, wie sie bislang für organisierte Kooperationen vorausgesetzt werden mußten, auflösen und diese technisch neu arrangieren (siehe Abbildung 4, vgl. Johansen, 1988).
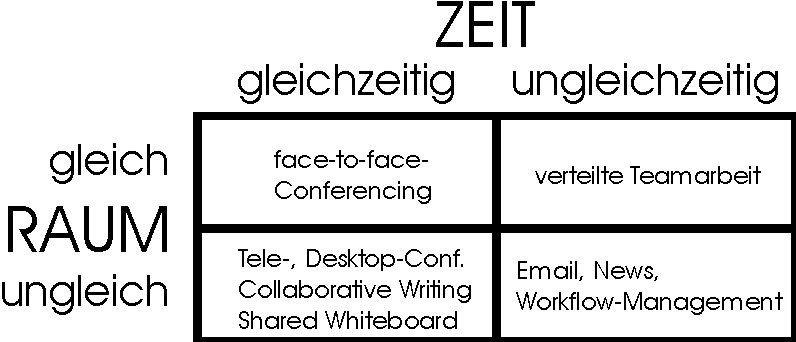
Kommunikationsnetze setzen soziale Gefüge durch ihre technische Abbildung tendentiell unter einen höheren Legitimationsdruck als bislang. Als
-- Ende S. 30 --ein Beispiel für die Explikation von Rollen durch die Anwendung des Internet, die die Latenz von Konflikten latent bedroht, sei auf web4groups (siehe W4G, 1996) hingewiesen. Hier wählen Autoren innerhalb eines Groupware-Systems klassische Rollen aus: Während die Rolle "Chefredakteur" jeden Text verändern darf, darf die Rolle "Redakteur" nur den von ihm erstellten Text bearbeiten, die Rolle "externer Beobachter" darf Texte nur lesen. Dies ist eine Strategie, um Akzeptanz für eine neue Technik durch Abbildung bekannter Muster zu gewinnen. Infolge des Zwangs zur Symbolisierung der Rolle und der Distanzierung durch Computer-vermittelte-Kommunikationen (bezeichnet als cmc, computer-mediated-communication, vgl. Hiltz, 1978; Rice, 1984; CMC, 1996; Übersicht: Kukulies, 1996) wird einerseits der Zusatzgewinn durch die Ausbeutung der informellen Seiten professioneller Sozialbeziehungen erschwert. Andererseits unterliegen Schwächere schärfer zugespitzten Beobachtungen, d.h. sie können ebenso wenig auf die latente Schonung durch Stärkere vertrauen.
In Betrieben lassen sich die E-Mails von Mitarbeitern leicht überwachen (vgl. Schmitz, 1996; zur wichtigen Unterscheidung von Inhalts- und Verkehrsdaten vgl. Gisor, 1996; zur Überwachung von E-Mail durch Geheimdienste vgl. Engelfriet, o.J.). Ebenso leicht können Mitarbeiter ihre E-Mails verschlüsseln (vgl. Rost/Schack, 1995). Werden Mitarbeiter zensiert, indem festgelegt wird, daß bestimmte Inhalte in den E-Mails nicht vorzukommen haben (weil sie privat sind) und daß E-Mails nur offen lesbar versendet werden dürfen (in verschlüsselten E-Mail könnten Firmengeheimnisse verraten werden), so expliziert dies ebenfalls das latente Machtgefüge und steigert den Legitimations- und Leistungsdruck.
-- Ende S. 31 --Insofern gibt es eine ganze Anzahl an Hinweisen dafür, daß die Implementation von Kommunikationsnetzen in Betrieben zunächst eher zur Verschärfung von ehedem latenten Konflikten führen (vgl. Griese, 1992). Lee Sproull und Sara Kiesler (Sproull/ Kiesler, 1992) berichten beispielsweise, daß die Konflikte durch Einführung von betriebsinternen Diskussionsforen so sehr eskalierten, daß einige der Kontrahenten aus dem Gebäude eskortiert werden mußten. Shoshana Zuboff (Zuboff, 1988) berichtet von der anfänglich euphorisch begrüßten Einführung einer Mailbox in einem Konzern, die dann wegen Unkontrollierbarkeit der Kommunikationen - es gab nur noch kleine Dienstwege - von der Konzernleitung in ihrem Leistungsumfang stark eingeschränkt wurde. Die durch das neue Medium freigesetzten Konflikte waren nicht mehr einzuholen.
Wenn das Medium jedoch etabliert ist, dürften Hierarchien, sobald sie erfolgreich gerechtfertigt werden können, wiederum als besonders gefestigt gelten. (Fußnote-10: Optimal für das Konfliktmanagement ist vermutlich eine Mixtur von E-Mail-Disputen und face-to-face-Verhandlungen, so meine Primärerfahrung. Als Herausgeber zweier Bücher, die ich per E-Mail koordinierte, habe ich gelernt: Je ernsthafter und folgenreicher Konflikte sich hätten entwickeln können, desto größer empfanden die Beteiligten den Druck, nicht mehr E-Mail zu benutzen, sondern in traditionelle Beziehungsformen (Telefonate, face-to-face-Gespräche) zurückzufallen, um die Konflikte zu lösen. E-Mail ist zwar vorzüglich zum Austausch von Fakten geeignet gewesen, sie reichte aber nicht hin, um die Gruppe als Gruppe zusammenzuhalten (vgl. dazu einige Anmerkungen in: Rost, 1996b). Erfahrungsgemäß kann es ferner zu Irritationen führen, wenn einer der Beteiligten den Austausch von E-Mail als kultivierten Briefwechsel wahrnimmt, während der andere E-Mail eher im Modus des rauhen Informierens und Nachfragens verwendet.) Die Legitimation im Bereich der Informationsverarbeitung wird vermutlich zukünftig stärker mit Nachweis der Funktionalität und Leistung gelingen und weniger mit dem Hinweis auf den Status.
Wenn Wissenschaftler, Sozialpolitiker, Ökonomen, Gewerkschafter oder Essayisten im Zusammenhang mit Computernetzen von Globalisierung sprechen, haben sie vorrangig die weltweit stattfindende Auslagerung von Betriebsteilen im Blick. Die negative Seite daran thematisieren sie als Fragmentierung und meinen damit Entsolidarisierung, Entpolitisierung oder Bedrohung des Normalarbeitsplatzes und der sozialstaatlichen Arrangements insgesamt (vgl. schon problembewußt: Gruppe hochrangiger Experten, 1996). Möglich ist die Virtualisierung von Unternehmen (vgl. Picot et al., 1996) dabei nur aufgrund der vorgängig geleisteten Integration durch Computernetze. Soziologisch gilt es deshalb zu beobachten, welche zum Beispiel spezifisch neuen Politisierungs-
-- Ende S. 32 --potentiale durch Computernetze weltweit aktiviert werden. Eine einseitige Verlustsemantik trifft nur zu, wenn das 19. Jahrhundert die Referenz bildet, als Arbeiter in Fabriken auf Rufweite zusammengefaßt sich in zündenden Reden gegenseitig über ihre schlechte soziale Situation in Kenntnis setzten. Computernetze öffnen diesen Raum weltweit.
Literatur
- Bamme, Arno und Günter Feuerstein und Renate Genth und Eggert Holling und Renate Kahle und Peter Kempin, 1983: Maschinen-Menschen. Mensch-Maschinen. Grundrisse einer sozialen Beziehung, 1986, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Barlow, John P., 1995: Wein ohne Flaschen - Globale Computernetze, Ideen-Ökonomie und Urheberrecht, in: Bollmann, Stefan (Hrsg.), 1995: Kursbuch Neue Medien - Trends in Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur, 2. durchgesehene Auflage 1996, Mannheim, Bollmann Verlag: 79-106.
- van Bolhuis, Herman E. und Vicente Colom, 1995: Cyberspace Reflections, Brussels: VUB University Press.
- Borchers, Dieter, 1996: Mit Kampf und Krampf - Vergleich: Europe Online Deutschland, The Microsoft Network, T-Online, in: iX - Multiuser Multitasking Magazin - 1996/06: 94-103.
- von Borries, Volker, 1980: Technik als Sozialbeziehung: Zur Theorie industrieller Produktion, München: Kösel.
- Braun, Ingo, 1994: Geflügelte Saurier. Zur intersystemischen Vernetzung großer technischer Netze, in: Braun, Ingo und Bernward Joerges (Hrsg.), 1994: Technik ohne Grenzen, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Canzler, Weert et al., 1995: Die Datenautobahn. Sinn und Unsinn einer populären Metapher (WZB-Paper FS II 95-101); Berlin.
- Clausen, Lars, 1994: Krasser sozialer Wandel, Opladen: Leske + Budrich.
- CMC, 1996: CMC-Magazine, http://www.rpi.edu/ decemj/cmc/mag/index.html
- Deutsch, Markus, 1995: Unternehmenserfolg mit EDI. Strategie und Einführung des elektronischen Datenaustausches, Wiesbaden: Vieweg.
- Dierkes, Meinolf, 1990a: Technikgenese: Einflußfaktoren der Technisierung jenseits traditionaler Technikfolgenforschung, in: Biervert, Bernd und Kurt Monse (Hrsg.), 1989: Wahl durch Technik? Institution, Organisation, Alltag, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Donnerhacke, Lutz, 1996: Usenet: Die Einrichtung von Diskussionsforen; in: Rost, Martin (Hrsg.), 1996: Die Netzrevolution - Auf dem Weg in die Weltgesellschaft, Frankfurt am Main: Eichborn-Verlag.
- Durkheim, Emile, 1895: Die Regeln der soziologischen Methode, 1. Auflage 1984, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Eisenstein, Elisabeth, 1983: The Printing Revolution in
Early Modern Europe, Cambridge: U.P.
-- Ende S. 33 --
- Elias, Norbert, 1970: Was ist Soziologie? 4. Auflage 1981, München: Juventa.
- Engelfriet, Arnoud Galactus, o. J.: "Anonymity and privacy on the Internet", http://www.stack.urc.tue.nl/galactus/remailers/index.html.
- Esposito, Elena, 1993: Der Computer als Medium und Maschine, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 22, Nr. 5: 338-354.
- Eveland, J. D. und T. K. Bikson, 1987: Evolving Electronic Communication Networks: an empirical assessment, in: Office: Technology and People, Amsterdam: Elsevier Science Publishers, Nr. 3, Seite 103ff.
- Flichy, Patrice, 1994: Tele. Geschichte der modernen Kommunikation, Frankfurt am Main, New York: Campus.
- Fröhlich, Gerhard, 1993: 'Demokratisierung' der Wissenschaftskommunikation durch Fachinformationssysteme und Computernetze, 13. Österreichischer Kongreß für Soziologie, November 1993.
- Geistbeck, Michael, 1895: Weltverkehr - Die Entwicklung von Schiffahrt, Eisenbahn, Post und Telegraphie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, Hildesheim 1986, Gerstenberg-Verlag.
- Geser, Hans, 1989: Der PC als Interaktionspartner, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 18, Nr. 3.
- Giesecke, Michael, 1990: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Giesecke, Michael, 1992: Sinnenwandel, Sprachwandel, Kulturwandel - Studien zur Vorgeschichte der Informationsgesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Gisor, Marc, 1996: Von Anarchie bis Orwell - Die Subgesellschaft Internet, in: Rost, Martin (Hrsg.), 1996: Die Netzrevolution - Auf dem Weg in die Weltgesellschaft, Frankfurt am Main: Eichborn-Verlag.
- Goodman, Danny, 1995: Mythos Information Highway - Was bringt uns die Datenautobahn wirklich? Zürich: Midas.
- Goody, Jack und Ian Watt und Kathleen Gough, 1986: Entstehung und Folgen der Schriftkultur, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Gorz, Andre, 1983: Wege ins Paradies, Berlin.
- Gorz, Andre, 1989: Kritik der ökonomischen Vernunft - Sinnfragen am Ende der Arbeitsgesellschaft, Berlin: Rotbuch Verlag.
- Griese, J., 1992: Auswirkungen globaler Informations- und Kommunikationssysteme auf die Organisation weltweit tätiger Unternehmen, in: Staehle, Wolfgang H. und P. Conrad (Hrsg.), 1992: Managementforschung 2, Berlin; New York: 165ff.
- Groys, Boris, 1996: Der Autor im Netz, in: Heibach, Christiane und Stefan Bollmann (Hrsg.), 1996: Kursbuch Internet - Anschlüsse an Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur: Bollmann Verlag.
- Grundmann, Reiner, 1994: Über Schienen, Straßen, Sand und Perlen. Große technische Systeme in der Theorie sozialer Systeme, in: Braun, Ingo und Bernward Joerges (Hrsg.), 1994: Technik ohne Grenzen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Gruppe hochrangiger Experten, 1996: Eine europäische
Informationsgesellschaft für alle - Erste Überlegungen der
Gruppe hochrangiger Experten,
http://www.ispo.cec.be/hleg/hleg.html.
-- Ende S. 34 --
- Gumbrecht, Hans Ulrich und Karl Ludwig Pfeiffer (Hrsg.), 1988: Materialität der Kommunikation, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Haarmann, Harald, 1990: Eine Universalgeschichte der Schrift, Frankfurt am Main, New York.
- Halfmann, Jost und Gotthard Bechmann und Werner Rammert, 1995: Technik und Gesellschaft - Jahrbuch 8: Theoriebausteine der Techniksoziologie, Frankfurt am Main; New York: Campus Verlag.
- Heintz, Bettina, 1993: Die Herrschaft der Regel: Zur Grundlagengeschichte des Computers, Frankfurt am Main, New York: Campus.
- Helmers, Sabine und Ute Hoffmann, 1996: Demokratische Netzpolitik - (k)ein Platz für Agenten; in: Bulmahn, Edelgard und Kurt van Haaren und Detlef Hensche und Manuel Kiper und Herbert Kubicek und Rainer Rilling und Rudi Schmiede (Hrsg.), 1996: Informationsgesellschaft - Medien - Demokratie. Kritik - Positionen - Visionen, Marburg: BdWi-Verlag.
- Helmers, Sabine und Ute Hoffmann und Jeanette Hofmann, 1996: Standard Development as Techno-social Ordering: The Case of the Next Generation of the Internet Protocol, http://duplox.wz-berlin.de/docs/ipng.html.
- Hiltz, S. R. und M. Turoff, 1978: The network nation: Human communication via Computer, Reading, MA: Addison-Wesley.
- Hochgerner, Josef, 1986: Arbeit und Technik: Einführung in die Techniksoziologie, Stuttgart Berlin Köln Mainz: Kohlhammer.
- Hofmann, Jeanette, 1996: Politik im Internet - Ordnungselemente einer dezentralen Welt, http://duplox.wz-berlin.de/docs/zuk.html.
- Holling, Eggert und Peter Kempin, 1989: Identität, Geist und Maschine - Auf dem Weg zur technologischen Zivilisation, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Hosenfeld, Friedhelm, 1996: Next Generation, Internet-Protokoll Version 6: ein neues Kommunikationszeitalter? in: c't - magazin für computertechnik, 1996/11, Seite 380f.
- Hughes, Thomas P., 1983: Networks of Power. Electrification in Western Society, 1880-1930, Baltimore: John Hopkins U. P.
- Israel, Joachim, 1979: Der Begriff Dialektik - Erkenntnistheorie, Sprache und dialektische Gesellschaftswissenschaft, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Jaeger, Kurt, 1996: Anmerkungen zur zukünftigen Technik des Internet, in: Rost, Martin (Hrsg.), 1996: Die Netzrevolution - Auf dem Weg in die Weltgesellschaft, Frankfurt am Main: Eichborn Verlag.
- Joerges, Bernward, 1989a: Technische Normen - Soziale Normen? in: Soziale Welt, Jg. 40; Nr. 1/2, Seite 242-257.
- Johansen, Robert, 1988: Groupware: Computer Support for Business Teams, New York: The Free Press.
- Köhntopp, Kristian, 1996: Was ist das Internet? Ein Überblick, in: Rost, Martin (Hrsg.), 1996: Die Netzrevolution - Auf dem Weg in die Weltgesellschaft, Frankfurt am Main: Eichborn Verlag.
- Kosik, Karl, 1967: Dialektik des Konkreten - Eine Studie zur Problematik des Menschen und der Welt, 1. Auflage 1986, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Kubicek, Herbert und A. Rolf, 1986: Mikropolis. Mit
Computernetzen in die Informationsgesellschaft, 2. Auflage,
Hamburg.
-- Ende S. 35 --
- von Kuenheim, Haug und Theo Sommer (Hrsg.), 1996: Zeit Punkte. Der Mensch im Netz - Kultur, Kommerz und Chaos in der digitalen Welt, Hamburg: Zeitverlag Gerd Bucerius.
- Kukulies, Reiner, 1996: Übersicht zu CMC-Ressourcen im Internet, http://www.uni-koeln.de/themen/cmc/*.
- Linde, Hans, 1972: Sachdominanz in Sozialstrukturen, Tübingen: Mohr.
- Lottor, M., 1996: Internet Domain Survey, http://www.nw.com/zone/WWW/top.html.
- Luhmann, Niklas, 1984: Soziale Systeme - Grundriß einer allgemeinen Theorie, 1. Auflage 1987, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas, 1986: Ökologische Kommunikation - Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Luhmann, Niklas, 1990: Die Wissenschaft der Gesellschaft, 1. Auflage 1992, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas, 1996: Die Realität der Massenmedien, 2. erw. Auflage, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Lutz, Christian, 1990: Optionen des Informationszeitalters - Hyperindustrialisierung oder Kommunikationskultur? in: Weingarten, Rüdiger, 1990: Information ohne Kommunikation? Die Loslösung der Sprache vom Sprecher, Frankfurt am Main: Fischer.
- MacKie-Mason, Jeff und Hal Varian, 1995: The Economics of the Internet, ftp://gopher.econ.lsa.umich.edu/pub/Papers/Economics_of_the_Internet.ps.Z.
- Malm, Peer S., 1994: The unofficial Yellow Pages of CSCW - Groupware, Prototypes und Projects - Classification of Cooperative Systems from a Technological Perspective. Groupware in Local Goverment Administration. (Thesis for the degree of cand. scient in Informatics, in preparation) - University of Tromsö, ftp://gorgon.tft.tele.no/pub/groupware/cscw_yp.*, E-Mail: paal.malm@tft.tele.no.
- Marx, Karl, 1867: Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Frankfurt am Main 1976: Verlag Marxistische Blätter.
- Mayntz, Renate, 1993: Große technische Systeme und ihre gesellschaftliche Bedeutung, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie Jg. 45, Seite 97-108.
- MIDS (Matrix and Information Services), 1996: 3rd MIDS Internet Demographic Survey, http://www1.mids.org.
- Mumford, Lewis, 1964: Mythos der Maschine. Kultur, Technik und Macht. Die umfassende Darstellung der Entdeckung und Entwicklung der Technik, 1986, Frankfurt am Main: Fischer.
- Nickl, Markus, 1996: Web Sites - Die Entstehung neuer Textstrukturen, in: Heibach, Christiane und Stefan Bollmann (Hrsg.), 1996: Kursbuch Internet - Anschlüsse an Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur: Bollmann Verlag.
- Ong, Walter J., 1987: Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes, Opladen: WdV.
- Picot, Arnold und Ralf Reichwald und Rolf T. Wigand, 1996: Die grenzenlose Unternehmung, Wiesbaden: Gabler.
- Pool, Ithiel de Solla (Hrsg.), 1977: The Social Impact of the Telephone, Cambridge: MIT.
- Quarterman, John S., 1990: The Matrix - Computer Networks & Conferencing Systems Worldwide, Burlington: Digital Press.
- Rammert, Werner und Gotthard Bechmann (Hrsg.), 1989:
Technik und Gesellschaft - Jahrbuch 5: Computer, Medien und
Gesellschaft, Frankfurt am Main: Campus.
-- Ende S. 36 --
- Rammert, Werner, 1990: Plädoyer für eine Technikgeneseforschung. Von den Folgen der Technik zur sozialen Dynamik technischer Entwicklungen, in: Biervert, Bernd und Kurt Monse (Hrsg.), 1990: Wandel durch Technik? Institution, Organisation, Alltag, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- von Randow, Gero, 1996: Vor allem: leichter - Schreiben am Computer hat mit Entfremdung nichts zu tun, in: Die Zeit, Nr. 37, 6. September 1996, Seite 79.
- RFC, o. J.: Liste mit RFC, ftp://ftp.nisc.sri.com/rfc/rfc-index.txt.
- Rheingold, Howard, 1994: Virtuelle Gemeinschaften - Soziale Beziehungen im Zeitalter des Computers, Bonn: Addison-Wesley.
- Rice, R. E., 1984: Mediated Group Communication, in: Rice, R. E., 1984: The New Media, Beverly Hills, London, New Delhi, SAGE Publications.
- Rieger, Wolfgang, 1995: SGML für die Praxis, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
- Römer, Martin und Bernd Quendt und Peter Stenz, 1996: Autopiloten fürs Netz, Intelligente Agenten - Rettung aus der Datenflut, in: c't - magazin für computertechnik, 1996/03, Seite 156-162.
- Rose, Marshall T., 1990: The Open Book - A Practical Perspective on OSI, Englewood Cliffs (N. J.): Prentice-Hall.
- Rost, Martin und Michael Schack (Hrsg.), 1995: Der Internet-Praktiker - Referenz und Programme, Hannover: Verlag Heinz Heise.
- Rost, Martin (Hrsg.), 1996: Die Netzrevolution - Auf dem Weg in die Weltgesellschaft, Frankfurt am Main: Eichborn Verlag.
- Rost, Martin, 1996a: Wissenschaft und Internet: Zunft trifft auf High-Tech, in: Rost, Martin (Hrsg.), 1996: Die Netzrevolution - Auf dem Weg in die Weltgesellschaft, Frankfurt am Main: Eichborn Verlag.
- Rost, Martin, 1996b: Coautoren per Eail koordinieren, in: Rost, Martin (Hrsg.), 1996: Die Netzrevolution - Auf dem Weg in die Weltgesellschaft, Frankfurt am Main: Eichborn Verlag.
- Rost, Martin, 1996c: Vorschläge zur Entwicklung einer Diskurs-Markup-Language, in: Heibach, Christiane und Stefan Bollmann (Hrsg.), 1996: Kursbuch Internet - Anschlüsse an Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur: Bollmann Verlag.
- Schmidt, Susanne K. und Raymund Werle, 1994: Koordination und Evolution. Technische Standards im Prozeß der Entwicklung technischer Systeme, in: Rammert, Werner und Gotthard Bechmann (Hrsg.), 1994: Technik und Gesellschaft - Jahrbuch 7, Frankfurt am New York: Campus-Verlag: 95-126.
- Schmitz, Ulrich, 1996: Liebesgrüße vom Chef - Automatisierte Emailkontrolle über MIMEsweeper, in: iX - Multiuser Multitasking Magazin, 1996/11, Seite 80-85.
- Schneider, Volker, 1989: Technikentwicklung zwischen Politik und Markt: Der Fall Bildschirmtext, Frankfurt am Main, New York: Campus.
- Sohn-Rethel, Alfred, 1937: Warenform und Denkform, 1. Auflage 1978, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Spencer Brown, George, 1969: Laws of Form, 1977, New York: The Julian Press.
- Sproull, Lee und Sara Kiesler, 1992: Connections: New ways of working in the networked organization, Cambridge Massachussets: MIT Press.
- Statistisches Bundesamt (Hrsg.), 1994: Datenreport 1994, Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland, durchgesehener und aktualisierter Nachdruck 1995, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.
- Stegbauer, Christian, 1996: Euphorie und
Ernüchterung auf der Datenautobahn, Frankfurt am Main:
DIPA-Verlag.
-- Ende S. 37 --
- Steinmüller, Wilhelm, 1993: Informationstechnologie und Gesellschaft - Eine Einführung in die Angewandte Informatik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Stodolsky, David S., 1994: Frequently Asked Question (FAQ) list for comp.groupware, ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/comp.groupware.
- Stoll, Clifford, 1995: Die Wüste Internet. Geisterfahrt auf der Datenautobahn, Frankfurt am Main: Fischer.
- Strangmeier, Reinhard L. F. und Monika Setzwein und Hanno Petras, 1992: Technikgenese - Zu Stand und Perspektiven einer sozialwissenschaftlichen Technikforschung, Christian-Albrechts-Universität Soziologische Arbeitsberichte (CAUSA), Kiel (ISSN 0939-5253).
- Tanenbaum, Andrew S., 1990: Computer Netzwerke: Wolfram's Fachverlag.
- Tapscott, Don, 1996: Die digitale Revolution, Gabler Verlag.
- Thomas, Frank, 1995: Telefonieren in Deutschland. Organisatorische, technische und sämtliche Entwicklung eines großtechnischen Systems, Frankfurt: Campus.
- Vobruba, Georg, 1990: Strukturwandel der Sozialpolitik - Lohnarbeitszentrierte Sozialpolitik und soziale Grundsicherung, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Weingart, Peter (Hrsg.), 1989: Technik als sozialer Prozeß, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Winograd, Terry und Fernando Flores, 1986: Erkenntnis Maschinen Verstehen - Zur Neugestaltung von Computersystemen, 1989, Berlin: Rotbuch.
- Zuboff, Shoshana, 1988: In the Age of the Smart Machine, New York.