Zur Produktion der wissenschaftlichen Kommunikation im digitalen Zeitalter
V1.1 - Februar 2000
Martin Rost
Vorbemerkung
Dieser Artikel ist abgedruckt in:
Rost, Martin, 2001: Zur Produktion des Wissens im digitalen
Zeitalter; in: Universität Erfurt/ Heinrich Böll-Stiftung
2001: Universitäten in der Wissensgesellschaft (Erfurter
Universitätsreden), München, Iudicium-Verlag.
Die Web-Adresse lautet:
http://www.maroki.de/pub/sociology/mr_wkdz.html
Einleitung
"Mit Beharrlichkeit koexistieren Industrialisierung der Gesellschaft und handwerklich bleibende Intelligenzarbeit, die nirgends den Ansatz macht, die Stufe der großen Maschinerie und Kooperation zu erklimmen; das gilt für die in der Gesellschaft zerstreute unmittelbare Intelligenzarbeit der Produzenten ebenso wie für die berufliche. In der Industrieproduktion wird zwar die Intelligenztätigkeit angewendet, sie steckt ja bereits in der toten Arbeit (...). Sogleich zieht sie sich aber auf die handwerkliche Stufe wieder zurück." (Negt/ Kluge 1981: 442)
An diesem vor 20 Jahren formulierten Befund möchte ich mit der Behauptung anknüpfen, dass sich die Wissenschaftsinstitutionen durch die Nutzung des Internet nunmehr anschicken, ihre bislang zunftartig-handwerkliche Organisationsstufe wissenschaftlicher Produktion zu verlassen und sich zu industrialisieren.
Industrialisierung bezeichnet dabei den Zusammenhang von Arbeitsorganisation, Technikeinsatz und Selbstverständnis der beteiligten Personen in Organisationen. In der besonders augenfälligen technischen Hinsicht läßt sich die Umstellung von Handwerk auf Industrieproduktion am plötzlich vermehrten Einsatz von vernetzten Maschinen ablesen, die Menschen in ihrer Arbeit unterstützen oder ersetzen. Systematisch betrachtet liegt der Umstellung auf Industrieproduktion technisch die Reproduzierbarkeit von Maschinen durch Maschinen (Anders 1980) zugrunde. Durch die Selbstbezugnahme der Maschine ist eine Maschine nicht nur als ein großes, letztlich von Menschen geführtes Werkzeug zu verstehen, (Endnote 1) sondern als eine technische Realität sui generis, die ihre eigenspezifizierten technischen Formen mit einem eigensinnigen Einfluß auch auf soziale Systeme hervorbringt. Der Maschineneinsatz überhaupt und die Größe von Maschinen, man denke nur an Schiffe oder Windmühlen, die es lange schon vor der industriellen Revolution gab, reichen zur Charakterisierung industrieller Produktion nicht hin.
Die maschinelle Reproduktion von Maschinen durch Maschinen hatte die Nutzung der Wattschen Dampfmaschine zur Voraussetzung, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts als generalisierte, von engen Raum- und Zeitvorgaben gelöste "Energiemaschine" zur Verfügung stand. Erst mit der Anwendung der spezifischen Leistungsfähigkeit der Dampfmaschine auf sich selber wandelte sie sich von einer überwiegenden Holz-, zu einer Holz-Eisen-, zu einer Metallkonstruktion, was jeweils mit einer signifikanten Wirkungsgradsteigerung einherging.(Endnote 2) Diese Technisierung der Produktion lief parallel zur Umstellung der Organisation der Produktion. Aus vielen zunftartig verfaßten Manufakturen und Handwerksbetrieben wurden Fabriken mit einem hohen Grad an Standardisierung der Abläufe, Arbeitsteilung und Automatisierung. Die gesellschaftlichen Auswirkungen wiesen überwiegend in Richtung auf Demokratisierung und Steigerung der allgemeinen Wohlfahrt, zumindest in den industrialisierten Ländern.
Mit dem Aufbau speziell von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsnetzen ab der Mitte/ Ende des 19. Jahrhunderts, man denke beispielsweise an die ersten Gasleitungen in London, an den Eisenbahnbau oder den Bau von Telegrafie-Überlandleitungen, setzte ein eigenlogischer Druck auf den fortschreitenden Anschluß immer entlegenderer Landes- und Erdteile ein (vgl. Schivelbusch 1979). Die gleiche Entwicklung läßt sich beim Ausbau des Internet beobachten.
Nach der Vernetzung energiebasierter Arbeitsformen sind heute, auf der Basis großtechnisch-vernetzter Kommunikationstechniken, viele Dienstleistungen und Managementaufgaben technisiert. Man denke etwa an die zunehmend automatisierte Produktion von Software, an die Betreuung von Kunden oder den zumindest teilautomatisierten Workflow moderner Organisationen. Meiner Ansicht nach verabschiedete Daniel Bell auf Grundlage der starken Zunahme der Beschäftigten im Dienstleistungssektor zu früh die Industriegesellschaft (vgl. Bell 1979). Vielmehr zeichnet sich stattdessen erst mit der nunmehr anstehenden Industrialisierung auch der mit Informationsverarbeitung als Produkt befaßten Organisationen eine Vollindustrialisierung der Gesellschaft ab.
So viel in aller gebotenen Kürze über den Kontext, in dem meiner Ansicht nach die Produktion wissenschaftlicher Kommunikation heute steht. Ich möchte meine Argumentation von der anstehenden Industrialisierung der Wissenschaft nachfolgend in vier Schritten entwickeln:
Im ersten Schritt komme ich auf Wissenschaft als ein soziales System zu sprechen. Ich weise Wissenschaft als eigensinnig operierendes Kommunikationssystem aus, das sich anhand wahrheitsfähig formulierter Diskurse beobachtet und reproduziert. Mag Wissenschaft auch viel mit dem Denken, Beobachten und Forschen einzelner Menschen zu tun haben, so ist sie doch vornehmlich eine bestimmte Form der Kommunikation. Wissenschaftliche Kommunikation erreicht von dem Moment an ein industrialisiertes Niveau, von dem an wissenschaftliche Publikationen organisiert hochauflösend arbeitsteilig erstellt und in stark technisierter Weise weitgehend automatisiert aneinander schließen. Dies passiert als Folge der sich zunehmend zwischen Kommunikationsmaschinen und Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftler und deren Publikationen schiebenden Kommunikationsmaschinen in den Wissenschaftsinstitutionen. Diese Entwicklung hat durch die Nutzung der über das Internet vernetzten Computer eingesetzt.
In einem zweiten Schritt zeichne ich den gegenwärtigen Zustand des Wissenschaftsbetriebs und hier insbesondere den der Hochschulen nach. Hochschulen funktionieren als zunftartig verfaßte, vorindustriell produzierende Organisationen, die sich ihr Personal im Modus von Kunsthandwerkern halten und die aufgrund ihrer vergleichsweise geringen organisatorischen Differenzierung und ihrem geringen Technisierungsgrad über keine zeitgemäß hinreichende Leistungsfähigkeit verfügen. In der geringen Produktivität aufgrund der organisatorisch vergleichsweise primitiven Verfaßtheit und der darauf begründeten Vorbehalte des Personals gegen technische Innovationen, die sich in anderen Teilen der Gesellschaft bereits durchsetzten, besteht meines Erachtens die seit mindestens 30 Jahren anhaltende Krise der Hochschulen.
Im dritten Schritt erinnere ich kurz an die von Karl Marx entwickelte Figur der sozial-katalytischen Wirkung moderner Techniken. Der gesellschaftliche Einbau einer Technik, die sich innerhalb kurzer Zeit eigenlogisch entwickelt und dann weltweit diffundiert, erzeugt umgehend einen unwiderstehlichen Druck auf soziale Organisationen. Zugleich gilt auch umgekehrt, dass soziale Systeme sich bereits verändert haben müssen, um auf neue Techniken anders als auf abzuwetternde Störungen zu reagieren.
Im abschließenden vierten Schritt möchte ich die bis dahin entwickelten Stränge meiner Argumentation am Beispiel einer wissenschaftlichen Diskurs-Markup-Language zusammenführen. Ich möchte aufzeigen, wie sich konkret eine Standardisierung der wissenschaftlichen Kommunikationen vorstellen ließe. Diese Standardisierung wissenschaftlicher Kommunikationen ist eine wesentliche Voraussetzung für deren weitgehend automatisiert gestützte Produktion. Die Folgen für die wissenschaftlichen Institutionen sind dabei meines Erachtens kaum zu überschätzen. In historischer Analogie läge die Vermutung nahe, dass Wissenschaftsinstitutionen im Zuge ihrer Industrialisierung einen Ökonomisierung- und vor allem Demokratisierungsschub erfahren werden, der zu einer dramatischen Steigerung ihres Wirkungsgrads führen dürfte. Eine konkrete Folge für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wird dann vermutlich darin bestehen, dass es nicht hinreicht, das traditionelle Schreiben operativ-toter Texte fortzusetzen, sondern eigen-aktive und maschinell zugängliche Textobjekte zu programmieren. Auf Papier ist das nicht möglich. Insofern läßt sich in einer historischen Perspektive sagen: Das Projekt der Alphabetisierung, das mit dem Lesen, Rechnen und Schreiben anhob, findet mit der Fähigkeit zur Selbstkonstruktion von Automaten seinen Abschluß.
Schritt 1 - Wissenschaft als Sozialsystem
Ganz allgemein ausgedrückt, operieren soziale Systeme als Sinn verarbeitende Kommunikationssysteme. Der eigensinnige Ablauf wissenschaftlicher Kommunikationen läßt sich weder einem daran beteiligten einzelnen Bewußtsein noch der physikalisch-materiellen Umwelt zurechnen.
Um das Gemeinte an einem Beispiel zu verdeutlichen... Die Bedeutung des sozialen Verhältnisses Onkel-Sein-von ist weder ein Phänomen eines einzelnen Menschen, das seinem höchst subjektiven Denken entspringt, noch ist das Sozialverhältnis "Onkel" hinreichend etwa als ein Phänomen eines physikalischen Quantensprungs zu charakterisieren. Das Onkel-Sein-von ist als ein sozialer Tatbestand einer Sphäre eigener Art zuzurechnen.(Endnote 3) Das Wissenschaftssystem operiert in diesem Sinne als ein sozialer Tatbestand, genauer: als ein sich über bestimmte Kommunikationen reproduzierendes Sozialsystem.
Das Wissenschaftssystem unterscheidet sich von anderen Sozialsystemen, wie denen der Wirtschaft oder Politik dadurch, dass es im Zuge der Aufklärung, als man zunehmend merkte, dass Wissen und Gewißheit nicht länger in eins zu setzen waren, sich immer spezifischer herauskristallisierte und schließlich exklusiv nur noch solche Kommunikationen organisierte, die sich mittels der Differenz wahr/ unwahr orientierten. Mit anderen Worten: Moderne wissenschaftliche Kommunikation ist dadurch spezifisch geworden, dass sie sich als Wahrheitskommunikation durch sich selbst geschlossen hat. Wissenschaft reproduziert sich weder durch die operative Nutzung der Differenz von Recht und Unrecht noch der Differenz von Regierung und Opposition oder der Differenz von Zahlung und Nichtzahlung, sondern allein durch die fortgesetzte Formulierung wahrheitsfähiger Aussagen. Nur solange Wissenschaft Wahrheitskommunikationen in diesem Sinne reproduziert, handelt es sich um Wissenschaft.
Wenn es Verwaltungen, Unternehmen oder Interessensverbänden erfolgreich gelingt, bestimmenden Einfluß auf die wissenschaftliche Kommunikation zu nehmen, und selbstverständlich versuchen diese das beständig, so ist dies ein Indiz für die gering entwickelte Eigenkomplexität wissenschaftlicher Kommunikation im allgemeinen und der daran beteiligten Wissenschaftsorganisationen im besonderen. Für eine moderne Politik, Justiz und Ökonomie, die die funktionale Autonomie von Wissenschaft genau nicht zu brechen und in die eigenen Dienste einzuspannen versuchen, ist Wissenschaft jedoch nur solange tatsächlich interessant, solange Wissenschaft nicht dasjenige erzählt, was sie selber besser wissen können. Moderne Wissenschaft ist kommunikativ und institutionell gezwungen, den Unterschied zu anderen Systemen zu markieren und aufrechtzuerhalten.
Wissenschaft entwickelte und entwickelt für ihre operative Eigensinnigkeit Methoden der Beobachtung und Formen der Argumentation als Konditionierung von Begriffen, Sätzen, Modellen und Theorien anhand von Begriffen, Sätzen, Modellen und Theorien. Andere Materialien als diese stehen ihr nicht zur Verfügung. Diese müssen unter Bedingungen, die von Politik, Recht und Ökonomie maximal befreit sind, in einer sozusagen frei tragenden wissenschaftlichen Konstruktion, auf bestimmte Weise kommuniziert werden. Darüberhinaus gilt, dass ein Forscher, der einsam für sich arbeitend fantastische Dinge entwickelt, solange kein Wissenschaftler ist, solange er seine Entdeckungen und Konstruktionen nicht verschriftlicht, so dass diese dem weltweit operierenden wissenschaftlichen Diskurs und den daraus abgeleiteten, an wahr und unwahr orientierten wissenschaftlichen Prüfmethoden unterworfen werden können. Wissenschaft ist, im Unterschied zur Forschung, die Kommunikation von Wahrheit.
Warum muss ich betonen, dass Wissenschaft primär eine Form der Kommunikation, also ein eigensinnig soziales Geschehen ist? Dies scheint mir deshalb geboten, weil nach meinem Eindruck noch immer zwei Vorstellungen über Wissenschaft vorherrschen, die analytisch auf ein falsches Gleis leiten:
Zum einen die Vorstellung, dass Wissenschaft in einem ganz außergewöhnlichen Maße an kognitive Talente der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gebunden sei. Besondere kognitive Talente sind grundsätzlich für die Ausübung eines jeden Berufes sicher nicht hinderlich. Maßgeblich ist jedoch, wie die kommunikativen wissenschaftlichen Strukturen ausgeformt sind: Welche Kommunikationen werden auf welche Weise institutionell verstärkt, und welche Kommunikationen landen auf einem absterbenden evolutionären Seitenast? Erst dann können kognitive Talente Einzelner als solche erkannt und gewürdigt werden.
Und zum zweiten trifft man die Vorstellung an, dass Wissenschaft sich beliebig in den Dienst von Politik oder Wirtschaft stellen läßt. Zweifellos wird Wissenschaft nur dann nachgefragt, wenn sich ihre Art der Kommunikation auch politisch, rechtlich, und ökonomisch übersetzen läßt. Wohl gemerkt: übersetzen läßt! Doch bei aller Orientierung an der Möglichkeit zur Übersetzbarkeit kann Wissenschaft sich als Wissenschaft immer nur an die wissenschaftseigenen Methoden und Verwertungsformen halten. Verstoßen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegen diese eigensinnigen Methoden, sind sie wissenschaftlich diskreditiert. Im Diskurs der Scientific Community, so dieser denn tatsächlich stattfindet, muss sich der wissenschaftliche Gehalt erweisen. Deshalb ist der Diskurs funktional unerläßlich. Bleibt der Diskurs aus, kommunizieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Grunde ohne Deckung. Trotz der Vielzahl an Publikationen werden Diskurse praktisch nur selten geführt und bestenfalls in den Texten simuliert. Diese Diskrepanz zwischen dem wissenschaftstheoretisch hohen Stellenwert des Diskurses und der tatsächlichen Praxis rührt u.a. daher, dass bislang keine angemessen diskursstützenden Kommunikationstechniken zur Verfügung standen. Diese Situation schlechter technischer Unterstützung zum Führen weltweiter Diskurse, insbesondere auf schriftlicher Basis, hat sich in den letzten zehn Jahren jedoch drastisch geändert. Ich werde darauf zurückkommen.
Einen großen Einfluß auf die Arten des Zustandekommens wissenschaftlicher Kommunikationen haben die Wissenschaftsorganisationen. Hierzu zählen insbesondere die Hochschulen, die Institute, die Verlage, Zeitungsredaktionen und Kultusbehörden, zu einem gewissen Teil inzwischen sicher auch die Massenmedien und einige Bereiche der industriellen Forschung. Es lohnt deshalb, auf die gegenwärtig etablierten Sozialstrukturen von Wissenschaftsorganisationen, insbesondere auf die der Hochschulen, zu sprechen zu kommen. Und zwar deshalb, weil die Anforderungen an eine gesellschaftsweite wissensenschaftliche Kommunikation vergleichsweise nur noch unzulänglich durch die Wissenschaftsorganisationen erfüllt werden.
Schritt 2 - Wissenschaftsorganisationen
Der gegenwärtige Zustand des Wissenschaftsbetriebs läßt sich an drei Faktoren ablesen: 1. Am Ausmaß der kontrollierten Arbeitsteilung, die ein bestimmtes Niveau an Standardisierung wissenschaftlicher Kommunikationen voraussetzt. 2. Am Ausmaß des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechniken zur Bewältigung der allseits enormen Ansprüche an Wissenschaft, gerade auch von Wissenschaft an sich selber. Und 3. am Selbstverständnis der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Die Art und Weise, wie diese Faktoren zusammenhängen, bestimmt darüber, ob die Rede von der Industrialisierung der Wissenschaft, oder genauer gesagt: der Industrialisierung der Wissenschaftsorganisationen, tatsächlich zutrifft oder nicht.
Bislang ist das Ausmaß der kontrollierten Arbeitsteilung im Bereich der wissenschaftlichen Kommunikation gering entwickelt. Zusammenarbeit geschieht wenn überhaupt dann in additiver Form: Man wirft bestenfalls mehrere Aufsätze zu einer Aufsatzsammlung oder mehrere Kapitel zu einem Buch zusammen - und zeichnet dann einzeln für diese Teile als Autor. Der in der Regel gering auflösende Grad der Arbeitsteilung rührt vor allem daher, dass bislang kaum moderne Kommunikationstechniken, die die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern im Bereich der Kommunikation unterstützen, eingesetzt werden, obwohl diese Techniken spätestens seit Anfang der 90er Jahre zur Verfügung stehen. Hier denke ich etwa an Entwicklungen aus dem Bereich der Groupware, des Computer-Supported-Cooperative-Working (CSCW) oder eines zumindest teilautomatisierten Workflow-Managements. Bislang werden im Hochschulbereich bestenfalls E-Mails als Ersatz für Telefonate, Briefe oder Faxe ausgetauscht, es wird in Bibliotheken über das Internet oder in Datenbanken auf CD-Rom nach Literatur recherchiert oder es werden in teuren Pilotprojekten über Audio- und Video-Techniken Vorlesungen über das Internet an Universitäten anderer Städte weitergeleitet. Diese Art der Nutzung der neuen Techniken entwickelt keine neue Qualität im Hinblick auf die Automatisierung der wissenschaftlichen Kommunikationen. Hier werden schlicht alte Paradigmen im Medium der neuen Technikformen umgesetzt, die zwar insgesamt zu einer Beschleunigung und Effektivierung der Kommunikationen führen, nicht aber auch zu deren automatisierten Weiterverarbeitung.
Ganz besonders deutlich zeigt sich die konservative Verwendung neuer Techniken in der Nutzung einer Textverarbeitung wie WinWord. WinWord läßt sich nur im Sinne einer komfortablen Schreibmaschine einsetzen - allerdings stellen deren professionelle Benutzer ganz überwiegend auch gar keine anderen Ansprüche. Die Produktionsweisen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Bereich der wissenschaftlichen Kommunikation sind, trotz des verstärkten Einsatzes von Computertechnik, traditionell am Paradigma des Papierbeschreibens orientiert.
Dass hochauflösende Formen der Zusammenarbeit weder geschätzt noch als Funktionsbedingung organisationell vorausgesetzt werden, ist selbstverständlich nicht das persönliche Problem wissenschaftlicher Autorinnen und Autoren, sondern ist den überwiegend altertümlichen Sozialstrukturen der Wissenschaftsorganisationen anzulasten, die in ihrer gegenwärtigen Verfassung ein hochauflösendes Niveau der Standardisierung von Kommunikationen unmöglich machen. Ja, Standardisierungsbemühungen werden an den entscheidenden Machtpositionen gemieden und als Bedrohung der Person empfunden. Technische und organisatorische Innovationen diffundieren in Hochschulen nur träge, weil die Wissenschaftsorganisationen noch immer ganz klassisch als Zunftorganisationen, mit festen Weisungshierarchien, magischen Initiationsriten und patriachalen Sozialverhältnissen zwischen Meistern und Schülern ausgelegt sind.
Die Autorinnen und Autoren, Verlage, Institute taxieren einander nicht an der jeweiligen Leistungsfähigkeit für den an Wahrheit orientierten wissenschaftlichen Diskurs, sondern fast ausschließlich am Grad der Reputation des jeweils anderen. Die gegenwärtigen Wissenschaftsorganisationen und deren Mitglieder beobachten einander als Reputationsspender und Reputationsnehmer, die beide im Modus des Gnadegewährens und der persönlichen Fürsprache miteinander verbunden sind. Ein vielversprechender Jungmathematiker beispielsweise ist darauf angewiesen, dass sein Doktorvater(Endnote 4) Beziehungen spielen läßt, damit der Aufsatz des Jungsmathematikers eine Chance auf Publikation in einer allseits geachteten, teuren Mathematik-Zeitschrift hat. Der Geselle hängt auf Gedeih und Verderb vom strategischen Geschick seines Meisters ab, ihn günstig zu positionieren. Im traditionellen Wissenschaftsgefüge dient Reputation als unverzichtbares Maß für die in der Vergangenheit geleistete wissenschaftliche Leistungsfähigkeit. Reputation in diesem traditionellen Sinne ist jedoch von dem Moment an entwertet, von dem an technische Parameter der Leistungsbemessung wissenschaftlicher Kommunikationen quasi in Echtzeit zur Verfügung stünden. Auf diesen besonders neuralgischen Punkt werde ich im vierten Schritt zu spreche kommen.
Wie fest die Orientierung an den traditionellen Zunftstrukturen sitzt, zeigt sich beispielsweise an der immer wieder aufbrandenden Diskussion zu Studiengebühren, ob sie eingeführt werden sollen oder nicht. Aus meiner Sicht ist es ein besonders augenfälliger Indikator für das Ausmaß einer gelungenen Modernisierung der Hochschulen, ob Studierenden ein Ausbildungsgehalt, so wie es in Industrie und organisiertem Handwerk selbstverständlich ist, gezahlt wird oder nicht. Mit dem an den Hochschulen massenhaft vorhandenen intelligenten Personal in Form von Studentinnen und Studenten ginge die Organisation Hochschule nur dann sorgsam und professionell um, wenn dieses einen Wert hätte. Ein Ausbildungsgehalt hätte zwangsläufig eine stärkere Einbindung in die wissenschaftliche Produktion zur Folge. Erst unter einer solchen Prämisse wären zudem Einstellungstests an den Hochschulen sinnvoll und legitim. Die von der Bundesregierung beschlossenen Verbesserungen des Bafög Anfang 2000 und die Ablehnung von Studiengebühren weisen hier, trotz der falschen Begründungen, zumindest in die richtige Richtung.
Die zunftartigen Formen der Wissenschaftsorganisationen, die geringe Achtung vor den Auszubildenden, das geringe Niveau der technikgestützen Arbeitsteilung und Automation wissenschaftlicher Kommunikationen führen zu einem Selbstverständnis eines Wissenschaftlers bzw. einer Wissenschaftlerin, das in der Regel dem eines bornierten, an Ganzheitlichkeit orientierten Kunsthandwerkermeisters entspricht. Hochauflösende Arbeitsteilung im Team, Ziel- anstelle von Statusorientierung und Abgabe eines Teils der Produktgestaltungssouveränität nicht nur an geringer qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern sogar an Maschinen, zählt für Industriearbeiter seit 150 Jahren zum professionellen Erfahrungshorizont. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gilt dieser Horizont und die Art ihrer sozialen Einpassung bislang als undenkbar, als unzumutbar und auf keinen Fall als erstrebenswert. Zugleich stellen Wissenschaftler, auch aufgrund ihres noch immer relativ hohen gesellschaftlichen Ansehens, gern den Anspruch, über einen bevorzugten Zugang zur Praxis und hervorragende Urteilsfähigkeit zu verfügen. Es wird immer schwieriger, unter Beibehalt der alten Verhältnisse, diesen elitären Schein aufrechtzuerhalten.
Schritt 3 - Technik als sozialer Katalysator
Im 13. Kapitel des 1. Band des Kapitals analysierte Karl Marx bekanntlich die gesellschaftlichen Auswirkungen von Dampfmaschine und Werkzeugmaschine. Er zeigte, wie der Einsatz beider Maschinen einherging mit dem Ausbau riesiger Fabrikareale, in denen große Mengen an Menschen stetig zusammenarbeiteten, was wiederum zur Zunahme selbstbewußter politischer Akteure führte. So entstanden, als soziale Kennzeichen der industriellen Revolution, neue Organisationen, Gewerkschaften, politische Parteien und neue Staatsformen.
Marx befand sich mit den beiden zeitgenössischen Technologen Babbage und Ure, die er als Gewährsmänner für seine industriehistorischen Darstellungen heranzog, zwar auf der Höhe seiner Zeit, doch verfügten diese drei über keine angemessene Theorie des Transmissionsriemens, wie es damals hieß. Marx sah im Transmissionsriemen und den dazugehörigen Umlenkvorrichtungen folglich wenig mehr als eine Verlängerung der Dampfmaschine, deren Kraft weitergeleitet wurde (vgl. Marx 1976: 391ff). Aus der heutigen, kybernetisch instruierten Sicht ist am Transmissionsriemen dagegen weniger die Eigenschaft der optimalen Energieübertragung relevant, als vielmehr die Möglichkeit des kontrollierten Koppelns von Einzelmaschinen zu Gesamtmaschinerien, also sozusagen die maschinelle Steuerung der Energie. Der Transmissionsriemen entwickelt von dem Punkt an eine eigensinnige, von der Dampfmaschine gelöste Qualität, sobald der Transmissionsriemen über "eigene" Steuerungsleistung automatisiert verfügt. Das Internet fungiert in diesem Sinne als ein solcher generalisierter, weltumspannender Transmissionsriemen.
Diese Generalisierung automatisierbarer Kopplungsfunktionen rundet eine Entwicklung ab, die mit dem Stromgenerator bzw. dem Elektromotor und dem Stromnetz als großtechnischem System einsetzte. Das Internet erzeugt nunmehr einen eigenlogischen Entwicklungsdruck zum Ausbau weiterer Kommunikationsnetze, auch in den Entwicklungsländern (vgl. Afemann 1996/ Afemann 1999). Diesen unnachgiebigen Vernetzungsdruck spüren derzeit sämtliche Organisationen dieser Welt, weil sie in einen Wettlauf um eine möglichst intelligente Informationsverarbeitung gezwungen wurden.(Endnote 5)
Auf dem generalisierten Transmissionsriemen Internet können sich Steuerungsanweisungen bei Bedarf weltweit in wenigen Sekunden ausbreiten. Diese weitgehend automatisierten Steuerungsanweisungen können auch auf verschriftliche Kommunikationen zugreifen, wenn diese strukturell maschinennäher als bislang aufbereitet wurden. Was meine ich damit? Traditionell auf Papier gebannte Texte sind operativ sozusagen nur zweidimensional angelegt, von links oben bis rechts unten. Papiertexte enthalten aus technischer Sicht nur schlecht operationalisierbare Symbole. Digitalisiert vorliegende Texte verfügen darüber hinausgehend über eine weitere Dimension, die senkrecht zu den beiden Dimensionen des Papiers steht. In dieser dritten Dimension lassen sich die zu einem Text gehörigen Strukturen ausweisen, die den zweidimensional-operativ toten Text in einen Anweisungsautomaten verwandeln können. Anders gesagt: Mit der Nutzung des Internet entstehen zwangsläufig aktive Textobjekte, die vollautomatisiert beispielsweise einander E-Mails schicken und automatisch auswerten können, um daran weitere eigensinnige Operationen anzuschließen. Ich werde am Beispiel einer Diskurs-Markup-Language ausführen, wie so etwas konkret aussehen könnte.
Organisationen, die sich auf das Internet und dessen Steuerungsleistungen einlassen und die ihr Personal zunehmend stärker beispielsweise durch Workflow- oder intelligente Content-Managementsysteme zusammenbinden, verändern sich und das Selbstverständnis ihres Personals gründlich. Durch die Nutzung des Internet sind zwangsläufig Organisationen in einen Wettlauf um eine möglichst effiziente Form der Kommunikationsverarbeitung eingetreten. Sie müssen das klassische Call-Center-Problem lösen, wie mit den täglich mehr werdenden, zum Teil automatisch generierten E-Mails, Faxen und Briefen sowie Telefonaten optimal umzugehen ist, wobei gilt, Partner, Kunden und gefährliche Konkurrenten mit hoher Trennschärfe von den uninteressanten Störungen zu unterscheiden. Zugleich sehen sich Organisationen genötigt, sich selbst mit Eigenkomplexität und Binnendifferenzierungen anzureichern, um auch in hochturbulenten Umwelten bestehen zu können.
Diese Anforderungen verändern die Formen der internen Kommunikation der Organisationen genauso wie die Formen der Arbeitsteilung unter den Mitgliedern, die Formen der neu zu bändigenden Konflikte und die Formen des Selbstverständnisses des personalen Inventars der Organisationen. Sobald beispielsweise einer Organisation allein schlichte E-Mail zur Verfügung steht, lassen sich unterschiedliche Grade des Informiertwerdens nicht wie bisher fadenscheinig aber konfliktlösend mit der unzulänglichen Technik der Umlaufmappen einer Registratur begründen, sondern allein mit den unterschiedlichen Positionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aus dieser Sicht ist damit zu rechnen, dass die Verwendung von E-Mail zunächst einmal das Konfliktpotential einer Organisation steigert (frühzeitig beobachtet von Zuboff 1988).
Wenn die neuen technischen Möglichkeiten, die mit dem Internet entstehen, von den Hochschulen und deren Personal umgesetzt werden, dann verändern sich die Hochschulen drastisch. Aus den ehemaligen Manufakturen würden Industriebetriebe.(Endnote 6)
Was das im einzelnen genau heißen kann, ist nicht abzusehen. Eine schlichte historische Analogie zu den Entwicklungen zu Beginn der industriellen Revolution zu bilden, sollte sicher nicht zu weit getrieben werden. Man darf aber wohl vermuten, dass der anstehende Wandel im Ergebnis mit einer Demokratisierung und tatsächlichen Orientierung am Diskurs, die seit den Tagen Humboldts ohnehin auf der wissenschaftstheoretischen Agenda steht, einherginge. Die Demokratisierung der Hochschulen ist somit nicht länger eine bloß politische Forderung, in der noch die 68er-Hochschulreformversuche nachhallen, sondern sie ist eine knallhart funktionale Bedingungen zur Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen Hochschulbetriebs.(Endnote 7)
In dem abschließenden vierten Schritt möchte ich auf ein Beispiel für eine mögliche Entwicklung zur Standardisierung wissenschaftlicher Kommunikationen zu sprechen kommen, über die sich die bislang entwickelten Stränge zusammenführen lassen.
Schritt 4 - Textobjekte statt Layout
"Die >>Diskursgenres<< sind Modi der Satzverknüpfungen, die durch je verschiedenartige Zwecke bestimmt werden: Vergnügen bereiten (Poetik des Aristoteles), überreden (Topik), überzeugen (Analytik), urteilen (Ethik), affizieren (Kants Ästhetik) und zeigen (Wittgenstein) sind Zwecke, die jeweils besondere Verknüpfungen oder Verkettungen von Sätzen verlangen. Und auch wenn die Sätze sehr einfach sind, auch in der Konversation und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, kommt man beim Verknüpfen eines Satzes mit dem anderen um die Frage nicht herum, wie es weitergehen soll. Es muss weitergehen, man muss Sätze miteinander verknüpfen, und sei es durch ein Schweigen, das dann als Satz gilt; es ist notwendig. Notwendig aber ist nicht das >>Wie<<." (Lyotard 1985: 41ff)
Die Verwendung einer Textverarbeitung wie WinWord gilt vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vermutlich als eine zeitgemäß moderne Form der Verarbeitung von Texten. Meiner Ansicht nach ist das Gegenteil ist der Fall. Die herkömmlich benutzten Textverarbeitungen konservieren das papierorientierte Paradigma der "Schreibmaschine" und vernachlässigen unnötigerweise die Strukturaspekte von Texten. Nur wenn die Struktur von Texten explizit standardisiert ausgewiesen ist, können Texte hochauflösend arbeitsteilig und maschinell verarbeitet werden. Diese maschinelle Verarbeitung von Texten ist unumgänglich, damit Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftsorganisationen nicht vollends in der seit Ende des 18. Jahrhunderts stetig ansteigenden Informationsflut ertrinken.
Die Techniken, die dieser Strukturarmut von Texten entgegenwirken können, stehen seit langem mit der ersten Formulierung der Standard Generalized Markup Language (SGML) bereit (vgl. Rieger 1995). SGML wurde 1969 definiert und 1986 als ISO-Norm 8879 (International Standardization for Organisation) festgelegt.
SGML liefert Werkzeuge zur Kennzeichnung der Bestandteile von Dokumenten an die Hand. Die konzeptionelle Kernidee besteht dabei in der Unterscheidung von Daten, Format und Struktur eines Dokuments. Ein papierenes Dokument kann beispielsweise Texte und Abbildungen, ein elektronisches Dokument darüberhinaus auch Audio- und Videodaten sowie Hyperlinks, wie man sie heute aus dem World-Wide-Web kennt, enthalten.
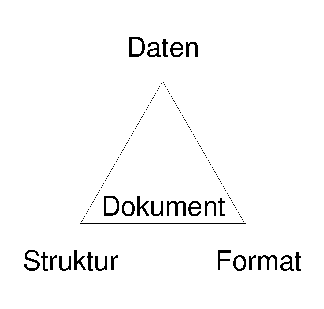
Abb. 1: Daten - Struktur - Format
Die Daten stellen die auf den Inhalt zielenden Mitteilungen dar. Unter Format ist all das zu verstehen, was mit der sinnlich wahrnehmbaren Erscheinung des Dokuments zu tun hat. Gewöhnlich bezeichnet man diesen auf Ergonomie zielenden Aspekt eines Dokuments als Layout. Mit Struktur eines Dokuments ist die Beziehung der Elemente zueinander gemeint, die bestimmte Funktionen füreinander erfüllen. Konkret gehören dazu etwa Überschriften, Gliederungen, Aufzählungen, Listen, Verweise, Fußnoten, Register, Anschriften, Anreden, Anhänge... kurz: Alles was das Auffinden und Verarbeiten der im Dokument enthaltenen Mitteilungen betrifft.
Ich möchte am Beispiel eines Geschäftsbriefes den Unterschied von Layout und Strukur zeigen (vgl. Abbildung 3):
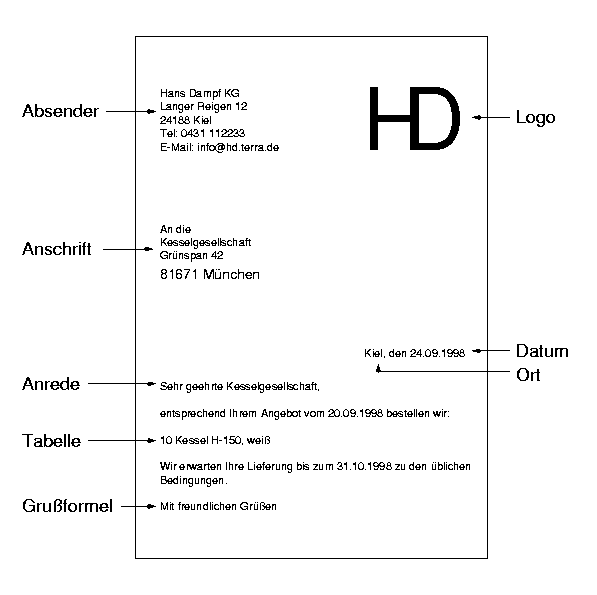
Abb. 2: Beispiel Geschäftsbrief, traditionelle Papierversion
Eine Sekretärin weiß, wie solch ein Geschäftsbrief strukturiert sein muss: Der Absender gehört in den Kopf des Briefes, ebenso das Logo. Die Anschrift folgt in der Mitte des oberen Drittels eines DIN-A4-Blattes, die Anrede im Abstand von fünf Zeilen tiefer, die Grußformel an den Schluß.(Endnote 8) Die Anordnung dieser Bestandteile spielt für die Interpretation der Daten eine große Rolle. Die Interpretation der Daten ergibt sich nicht einfach aus den Daten selbst. Das läßt sich am Beispiel des Unterschieds zwischen der Absender-Adresse und der Empfänger-Adresse sofort zeigen, weil beide Adreßangaben semantisch und syntaktisch identisch sind. Allein die Position auf dem Papier entscheidet darüber, welche Zeichen als Empfänger- und welche als Absender-Adresse zu interpretieren sind.(Endnote 9)
Welche maßgebliche Rolle die Struktur für die Interpretation der Daten spielt, zeigt sich spätestens beim Durcheinanderwirbeln der Bestandteile (vgl. die Abbildung 4.)
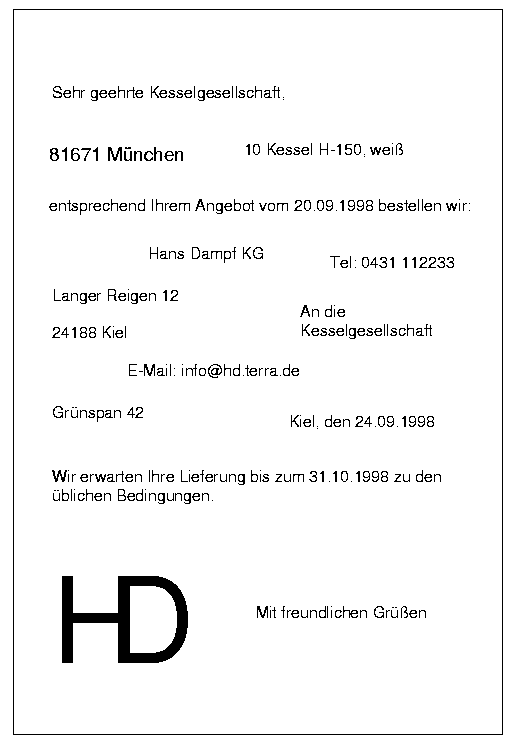
Abb. 3: Beispiel Geschäftsbrief, Papierversion, abweichende Struktur
Es ist die Struktur der Bezugnahmen der einzelnen Teile zu einem Gesamtdokument, die die Interpretationsanweisungen enthalten. Bei SGML wird die Definition einer solchen Struktur als eine Document-Type-Declaration (DTD) bezeichnet.
Die modernen Textverarbeitungen und DTP-Programme kennen derartige Strukturdefinitionen zumindest ansatzweise als Formatvorlagen. Zusammen mit den eingegebenen Daten und dem Layout werden solche Formatvorlagen in der Datei abgespeichert.(Endnote 10) Diese Informationen über die Strukturdefinition in Form der Formatvorlage gehen jedoch in vielen Fällen dann verloren, wenn die Daten elektronisch zur Weiterverarbeitung weitergegeben werden und der Empfänger einer solchen Datei nicht das exakt gleiche Textverarbeitungsprogramm benutzt. Und leider sind beispielsweise die weitverbreiteten WinWord-Dateien ja nicht einmal verläßlich zu sich selbst kompatibel. Wird ein Dokument beispielsweise im RTF-Format abgesichert, das bekanntermaßen speziell als universelles Austauschformat zwischen verschiedenen Textverarbeitungen geschaffen wurde, und per E-Mail jemandem zugeschickt, dann gehen diese so wichtigen Strukturdefinitionen in jedem Fall verloren und das einlesende Textverarbeitungsprogramm muss beim Versuch der Strukturgewinnung zu einem guten Teil die Struktur eines Textes regelrecht erraten. Und selbst wenn die Strukturdefinitionen erhalten bleiben, weil der Empfänger das exakt gleiche Programm benutzt, dann führt dies nur dazu, dass am Ende zwar Struktur und Layout identisch sind, aber es findet die eigentlich entscheidende Operation, nämlich die möglichst maschinell gestützte Weiterverarbeitung der Daten, nicht statt.
Was haben diese technischen Details mit unserer Fragestellung der Technisierung wissenschaftlichen Wissens zu tun?
Wenn eine verläßlich standardisierte Struktur für Dokumente zur Verfügung stünde, dann könnten Maschinen Texte weitgehend automatisch verarbeiten, wie dies etwa bei Datenbanken geschieht. Steht keine Struktur zur Verfügung, bleibt zur Weiterverarbeitung immer nur die Hand- und Kopfarbeit von Menschen übrig, weil von Layout auf Struktur nicht maschinell rückgeschlossen werden kann. Das Problem mit den konventionellen Textverarbeitungen besteht darin, dass sie weitgehend daraufhin ausgelegt sind, die Schwächen von Schreibmaschinen im Bereich des Layouts zu beheben. Die Verwendung standardisierter Struktur-Markup-Languages würde diese Schwäche beheben. Doch leider ist das traditionelle Layout-Paradigma noch so stark wirksam, dass beispielsweise sogar die Struktur-Markups, die HTML, die Markuplanguage des World-Wide-Web, zu Beginn der Entwicklung noch zur Verfügung stellte (wie beispielsweise die Tags <strong>, <cite>, <em>, <code>, ...) heute nahezu bedeutungslos, ja obsolet geworden sind.
Wie würde eine Bestellung, die man mit SGML formulierte, per E-Mail abschickte und die vom Empfänger dann automatisch weiterverarbeitet würde, aussehen? Vermutlich ähnlich wie folgt:
<gbrief>
<adresse>Kesselgesellschaft</adresse>
<angebot>24.02.2000</angebot>
<bestelliste>
<anzahl>10</anzahl>
<artikel>Kessel H-150</artikel>
</bestelliste>
<termin>31.03.2000</termin>
</gbrief>
Abb. 4: Beispiel Geschäftsbrief, SGML-Version
Der Rest der für die automatische Bearbeitung nötigen Informationen würde aus einer Datenbank ergänzt werden.
In einem kleinen Maßstab bestellen einige Apotheken und Autowerkstätten seit wenigen Jahren schon bei ihren Großhändlern auf diese Weise. In manchen Verwaltungen werden zunehmend häufiger zwar nicht Standards gemäß SGML, wohl aber gemäß Electronic Data Interchange (EDI) eingesetzt, was prinzipiell nichts anderes ist. SGML wird von den Militärs in den USA sowie beispielsweise von Boeing, VW sowie Herstellern großer Lexika verwandt. Und natürlich ist insbesondere der elektronische Handel an den Börsen zu erwähnen. Derzeit sieht es so aus, als wenn XML (eXtensible Markup Language), ehemals eine Untermenge von SGML, zum entscheidenden, evolutionär irreversiblen Durchbruch im Bereich der Standardisierung der Kommunikationen führen wird (vgl. Bager 1998, 308ff; Behme/ Mintert 1999).
Die Frage ist, ob sich dieses Prinzip auch auf wissenschaftliche Kommunikationen übertragen läßt. Ich denke, dass sich das ohne größere Schwierigkeiten machen ließe. 1996 habe ich in diesem Sinne einen ersten konzeptionellen Vorschlag für eine Diskurs-Markup-Language unterbreitet (vgl. Rost 1996c). Die Kernidee ist einfach: Man definiere ein Set von Markup-Zeichen im Stile von SGML, um dadurch die Strukturen wissenschaftlicher Kommunikationen zu explizieren.(Endnote 11)
Mit Hilfe einer solchen Diskurs-Markup-Language ist es möglich, die Struktur einer Argumentation innerhalb eines Dokuments sowie die Struktur eines Diskurses insgesamt zu beschreiben. Zur Kennzeichnung der Struktur von Daten, die innerhalb wissenschaftlicher Diskurse typischerweise benutzt werden, bedarf es einer ganzen Reihe an Markups, wie etwa der folgenden Art: THESE, DEDUKTION, INDUKTION, ABDUKTION, ANMERKUNG, HINWEIS, ANEKDOTE, BEISPIEL, FRAGE, ANTWORT, ZUSAMMENFASSUNG, ZUSTIMMUNG, ABLEHNUNG, ZWEIFEL, BESTÄTIGUNG, PROGNOSE, BEOBACHTUNG.
Solche Markups, die die allgemeinen Elemente einer Art Diskurs-Grammatik bezeichneten, ließen sich dann jeweils mit Attributen versehen, um differenziertere Anschlüsse von Sätzen an Sätze ausweisen zu können. ANMERKUNGEN etwa wären beispielsweise in historische, soziologische, logische, linguistische, psychologische, mathematische, etymologische, physikalische oder natürlich auch in ökonomische und politische zu unterteilen. Zusammengehalten wird dieses Set an Markups unter dem Aspekt, ob sie die kontrollierte Oszillation zwischen wahren und falschen Aussagen gestatten.
Ein mit einer Diskurs-Markup-Language strukturiertes Dokument könnte beispielsweise wie folgt aussehen:
<!DOCTYPE SOCIOLOGY-DML.DTD "-//W3C//DML 5.0//DE"> <GETLINK:SOCIOLOGY> <PUTLINK:SOCIOLOGY>Computernetze, industrielle Revolution</PUTLINK> <BODY> <THESE1>Computernetze vollenden das Industrialisierungs-Projekt</THESE1> <ANMERKUNG1:THESE1> Die gewagte Verwendung des Begriffs <M>Vollendung</M> bezieht sich auf die der Physik entlehnten Differenz von Energie und Information: Nachdem sich die mit Energieumwandlungen befaßten gesellschaftlichen Bereiche bereits seit dem 19. Jahrundert in einem Prozeß der Industrialisierung befinden, werden nun auch die gesellschaftlichen Bereiche der Informationsverarbeitung erfaßt. </ANMERKUNG> <THESE2> Eine <M>Industrialisierung</M> geht einher mit der Zunahme der <M>Demokratisierung</M>, <M>Kapitalisierung</M> und <M>Verwissenschaftlichung</M> einer <M>Gesellschaft</M> und bedeutet technisch eine maschinelle Herstellung von <M>Maschinen</M> durch Maschinen. <GETLINK:HISTORY,POLITOLOGY,ECONOMY,TECHNOLOGY> </THESE2> <DEDUKTION:THESE1-THESE2><PUTLINK:SOCIOLOGY> Mit der Nutzung der Computernetze vollendet sich die Demokratisierung, Kapitalisierung und Verwissenschaftlichung einer Gesellschaft. </PUTLINK></DEDUKTION> </BODY>Abb. 5: Beispiel für ein Dokument, DML-strukturiert
Es kann mir jetzt hier nicht darum gehen, Details einer solchen Diskurs-Markup-Language zu diskutieren - diese fielen dann doch um einiges komplizierter aus, als ich es hier ansprechen kann - sondern ich möchte an diesem Beispiel primär den Strukturaspekt von Kommunikationen vermitteln und zeigen, wie sich dabei die technische und die soziale Dimension der Kommunikation ineinander verschränken.
Ich denke, es ist nach diesem Beispiel relativ leicht, sich vorzustellen, wie derartig strukturierte Texte auch maschinell zugänglich wären, wenn sie zu einem Gesamttextbestand einer auf Soziologie spezialisierten Datenbank im Internet integriert würden. In einem derartig durchstrukturierten Textbestand ließe sich naheliegender Weise ungleich gezielter recherchieren und es zeigten sich zwangsläufig beispielsweise evolutionäre Seitenäste wissenschaftlicher Kommunikationen, die auch maschinell abgeschritten und geprüft werden könnten. Die Diskurse der Scientific Society wären ungleich höher standardisiert führbar, die Organisation von Forschungsprojekten ließe sich zielgerichteter und arbeitsteiliger als bislang ausrichten. Der Widerstand gegen diese Entwicklung wird kräftig sein.
Schlußbemerkung
Die derzeitige Lage ist brisant. Ich empfinde sie als Ruhe vor dem Sturm. Das Management vieler Betriebe und Hochschulinstitute hat inzwischen durchgängig auf EDV umgestellt und vielfach Internet eingeführt. Die Mitarbeiter wissen, trotz der überwiegend noch immer miserablen Ausbildungssituation, zunehmend besser, mit der Technik umzugehen. Man ist der Ansicht, dass die Anforderungen an moderne Kommunikationsinfrastrukturen somit weitgehend erfüllt seien und wieder Ruhe in die bislang aufgeregt geführten Debatten um Computerisierung und Vernetzung einkehren könne. Es wird vielfach Entwarnung signalisiert. Tatsächlich sind jedoch gerade erst die technischen und organisatorischen Bedingungen für die nunmehr einsetzende Standardisierung und Maschinisierung insbesondere auch der wissenschaftlichen Kommunikation geschaffen worden. Der nunmehr anstehende Wandel geschieht rasch, eigensinnig und gründlich, hinter dem Rücken der Akteure.
Literatur
- Afemann, Uwe, 1996: Zur Bedeutung der neuen
Kommunikationstechnologien in der >>Dritten Welt<< am
Beispiel des Internet, in: Bulmahn, Edelgard/ Haaren, Kurt van/
Hensche, Detlef/ Kiper, Manuel/ Kubicek, Herbert/ Rilling, Rainer/
Schmiede, Rudi (Hrsg.), 1996: Informationsgesellschaft - Medien -
Demokratie. Kritik - Positionen - Visionen, 1. Auflage, Marburg:
BdWi-Verlag: 219-233.
- Afemann, Uwe, 1999: Internet als Chance für den
Bildungsbereich in Enwicklungsländern?; in: Drossou, Olga/ van
Haaren, Kurt/ Hensche, Detlev/ Kubicek, Herbert/ Mönig-Raane,
Margret/ Rilling, Rainer/ Schmiede, Rudi/ Wötzel, Uwe/ Wolf,
Frieder Otto (Hrsg.), 1999: Machtfragen der Informationsgesellschaft,
Marburg: Forum Wissenschaft, Studien Bd. 47: BdWi-Verlag: 575-586.
- Anders, Günther, 1980: Die Antiquiertheit des Menschen.
Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten
industriellen Revolution, Bd. 2, 1984, Zürich: Buchclub Ex
Libris.
- Bager, Jo, 1998: Der Turmbau im Web. XML - des WWW neue Sprachen;
in: c't 1998/ 21: 308-314.
- Behme, Henning/ Mintert, Stefan, 1999: XML in der Praxis
- Bell, Daniel, 1979: Die nachindustrielle Gesellschaft, Reinbek
bei Hamburg: Rowohlt.
- Durkheim, Emile, 1984: Die Regeln der soziologischen Methode, 1.
Auflage, 1984, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Habermas, Jürgen, 1985: Theorie des kommunikativen Handelns,
Bd. 1 und 2, 3. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas, 1992a: Die Wissenschaft der Gesellschaft, 1.
Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Lyotard, Jean-Francois, 1985: Immaterialität und
Postmoderne, Berlin: Merve-Verlag
- Marx, Karl, 1976: Das Kapital - Kritik der politischen
Ökonomie, Erster Band, Frankfurt am Main: Verlag Marxistische
Blätter.
- Negt, Oskar/ Kluge, Alexander, 1981: Geschichte und Eigensinn, 8.
Auflage, Frankfurt am Main: Verlag 2001.
- Nentwich, Michael, 1999: Cyberscience: Die Zukunft der
Wissenschaft im Zeitalter der Informations- und
Kommunikationstechnologien, MPIfG Working Paper 99/6, Mai 1999.
http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/publikation/working_papers/wp99-6/index.html
- Popper, Karl R., 1973: Objektive Erkenntnis, Hamburg.
- Rieger, Wolfgang, 1995: SGML für die Praxis, Berlin,
Heidelberg: Springer-Verlag.
- Rost, Martin, 1996c: Vorschläge zur Entwicklung einer
Diskurs-Markup-Language; in: Heibach, Christiane/ Bollmann, Stefan
(Hrsg.), 1996: Kursbuch Internet - Anschlüsse an Wirtschaft und
Politik, Wissenschaft und Kultur: Bollmann-Verlag
(http://www.maroki.de/pub/sociology/mr_dml.html).
- Schivelbusch, Wolfgang, 1979: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur
Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, Frankfurt am
Main.
- Wingens, Matthias, 1998: Wissensgesellschaft und
Industrialisierung der Wissenschaft, Wiesbaden: Deutscher
Universitäts Verlag.
- Zuboff, Shoshana, 1988: In the Age of the Smart Machine: The
Future of Work and Power, Oxford: Oxford University Press.
1 Endnoten
Endnote 1 - Obwohl ein solches Verständnis etymologisch naheliegen mag: "Maschine [frz., aus grch. mechane >Werkzeug<], jede Vorrichtung zur Erzeugung oder Übertragung von Kräften, die nutzbare Arbeit leistet (Arbeitsmaschine) oder die eine Energieform in eine andere verwandelt (Kraftmaschine) (...)", DTV-Lexikon 1995: 11/ 294 - zurück -
Endnote 2 - Mit diesem systematischen Kriterium der Selbstanwendung einer neuen, paradigmabildenden, weil generalisierenden Technik auf sich selber, lassen sich historisch drei einschneidende Phasen der gesellschaftlichen Entwicklung unterscheiden: Die Erstellung von Werkzeugen durch Werkzeuge im Tier-Mensch-Übergangsfeld, die maschinelle Herstellung von Maschinen zu Beginn der industriellen Revolution sowie die großtechnische Produktion von großtechnischen Systemen aus großtechnischen Systemen am Ende des Projekts der Industrialisierung. - zurück -
Endnote 3 - Diese Formulierungen nehmen Bezug zum einen auf Durkheim sowie auf die durch Habermas modifizierte Form der "3-Welten-Theorie" Karl Poppers (vgl. Durkheim 1984; Popper 1973; Habermas 1985). - zurück -
Endnote 4 - Eine Bezeichnung, die die anachronistischen Verhältnisse an den Hochschulen auf das Beste offenbart. - zurück -
Endnote 5 - In einem ähnlichen Ausmaß sahen sich die kleinen Landgemeinden in Deutschland in den 20er und 30er Jahren gezwungen, sich an die Strom- und Telefonversorgung anzuschließen, nachdem der Grundausbau mit Ver- und Entsorgungskanälen, Ausbau von Straßen und Schienen ein vorläufiges Ende gefunden hatte. - zurück -
Endnote 6 - Wenn auch Ansatz und Fokus differieren, so stimme ich im Ergebnis Matthias Wingens zu, wenn er schreibt: "Die allgemeine These, die ich in meiner Arbeit entwickeln möchte, ist, dass die Kehrseite erfolgreicher Verwissenschaftlichungsprozesse der technisch-ökonomischen Grundstruktur der Gesellschaft wie der Gesellschaft insgesamt eine >>Industrialisierung der Wissenschaft<< ist. Diese beiden strukturellen Entwicklungsphänomene stellen zwei nur analytisch zu trennende Momente desselben gesellschaftlichen Modernisierungs- und Rationalisierungsprozesses dar: die Industrialisierung der Wissenschaft ist das funktionale Korrelat der Verwissenschaftlichung der Industrie bzw. gesellschaftlicher Handlungsbereiche generell." (Wingens 1998: 22) - zurück -
Endnote 7 - Zu den anstehenden Umbrüchen in den Wissenschafts-Organisationen siehe Nentwich 1999. - zurück -
Endnote 8 - Im Unterschied zu einem hierarchisch aufgebauten Geschäftsbrief weist ein Buchdokument darüberhinaus häufig auch nicht-hierarchische Elemente auf. Man denke dabei an Fußnoten, Marginalien, Kopf- oder Fußzeilen, Literatureinträge, Register usw. Diese nichtlinear angeordneten Bestandteile haben Verweischarakter. Sie setzen Bestandteile eines Dokuments explizit in eine nicht zwingend hierarchische Beziehung und können an beliebiger Stelle im Text auftreten (vgl. Rieger 1995: 11-38). Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für nicht-lineare Elemente sind die Hypertext-Links des World-Wide-Web. - zurück -
Endnote 9 - Im vorliegenden Beispiel ließe sich über die Position hinaus auch die Anrede "An die..." zur Identifikation der nachfolgenden Zeilen als Empfangsadresse heranziehen. - zurück -
Endnote 10 - Dies ist der Grund dafür, weshalb auch kurze Dokumente eine Menge Plattenplatz beanspruchen. - zurück -
Endnote 11 - Mittlerweile sind eine ganze Reihe an Entwürfen für spezielle wissenschaftliche Markups vorgelegt worden, siehe etwa die "Ontology Markup Language" oder Conceptual Knowledge Markup Language. - zurück -